|
Mutterwitz aus dem Vaterhaus
Schnurren, Schnorken und Humoresken von 15 Schriftstellern.
Aus dem Erzgebirgischen in das Hochdeutsche übertragen und kommentiert
von
Gotthard B. Schicker
mit Illustrationen aus dem “Fränkischen Volkstum”
vom Annaberger Maler Rudolf Köselitz (1861-1948)
Inhaltsverzeichnis
Vorwort
Kleiner Hochzeitswurm
(aus dem Alt-Erzgebirgischen, 1659)
HEINRICH KÖSELITZ (Peter Gast)
1854 Annaberg -1918 Annaberg
Der Besenbinder
(Dr Baasnbinder)
Einem geschenkten Gaul...
(Enn geschentn Gaul...)
Wurst gegen Wurst
(Worscht wider Worscht)
Der Hammerschmied
(Dr Hammerschmid)
Versprochen
(Verplappert)
Das Rechen-Exempel
(s´ Rachn-Exempl)
Paukers Weisheit
(Paukenschleger-Weisheet)
Die Teich-Türe
(De Teich-Thir)
Der unselige Schornstein
(De unsaalche Feiereß)
Ein großes Bündel Heu
(Ä gruß´ Bündl Hei)
Stoßseufzer eines Crottendorfer Räucherkerzchenjungen im Winter
(Stußseifzer von enn Kruutnderfer Räächer-Kerzl-Gung in Winter)
FRITZ KÖRNER
1873 Waschleite – 1930 Beierfeld
Nebukadnezar
(Nebegadnezer)
ANTON GÜNTHER
1876 Gottesgab – 1937 Gottesgab
Auf einem Hirsch geritten
(Of´n Hirsch gerieten)
O du verkehrte Welt
(O du verkehrte Walt)
Wegen eines Kusses
(Waagn enn Schmatz)
Bei der Firmung
(Be dr Firming)
Der Schatten
(Dr Schattn)
Beim Vogelstellen
(Ben Vugelstelln)
Der einzige Bettelmann
(Der aanzige Battelma)
Vom Schmuggeln
(Ven Paschen)
Die Sakramente
(De Sakrementer)
Der Kalender
(Der Kalender)
Von der Johanna Wagner
(Ve de Wogner Nann)
Judensklaven
(Judensklaven)
Da drücke ich immer die Augen zu.
(Do drück ich immer de Aagn zu)
Die geht auch hinüber
(Die gieht rüber aah)
Wegen des Wetters
(Waagne Watter)
Aus der Hungerzeit
(Aus der Hongerzeit)
Viele Peter
(Lauter Peter)
Guten Abend!
(Guten Obnd!)
In Cranzahl
(In Cranzahl)
Kopfarbeit
(Kopparbit)
Wegen dieses unmöglichen Menschen
(Waagn dan Dingerich)
Von der Mode
(Ve der Mode)
Magenkatarrh
(Mognkatarrh)
Die Beine
(De Baa)
Eine gute Antwort
(E gute Antwort)
Eine Nebelgeschichte
(Ene Naabelgeschicht)
Anton Günther
(Tolerhanstonl)
Die letzten Sprüche von Anton Günther aus dem Jahre 1936
HEINRICH JACOBI
1845 Schneeberg – 1916 Schneeberg
Die Zehnterkasse
(De Zahntenkasse)
MAX WENZEL
1879 Ehrenfriedersdorf – 1946 Chemnitz
Sieben Jäger
(Siebn Gager)
Auch richtig!
(Aa richtig!)
Der Teufel im Frohnauer Hammer
(Der Teifel in Frohnaer Hammer)
Vom alten Gemeindevorstand X.
(Von alten Gemaavirstand X.)
Die Ähnlichkeit
(De Ahnlichkät)
Sonntagsruhe
(Sonntigsruh)
Der ewige Arbeitsmann
(Der ewige Arbeitsmaa)
Eine Diskussion über das Schnarchen
(E Dischkur über´n Schnarchn)
Die Großen sind die Großen!
(De Grußen sei de Grußen!)
Beim Friseur (Wundheiler, Badeknecht, Bartschneider)
(Ben Balbier)
Die Pyramide
(De Peremett)
Wie das Volk spricht...
(Wie´s Volk redt...)
EMIL MÜLLER
1863 Annaberg – 1940 Dresden
Du weißt nicht, was du willst
(Du weßt net, wos de willst)
HERMANN LÖTSCH
1880 Annaberg – 1943? Lübeck
Der Wettlauf
(Dr Wettlaaf)
ALBERT SCHÄDLICH
1883 Elsterberg – 1933 Lauter
Stöckraustu
(Wurzeln/Stöcke von abgesägten Bäumen ausgraben)
Der Lumpenmann
(Dr Lumpenma)
Der letzte Pfannkuchen
(Dr letzte Pfannkuchn)
HANS SOPH
1869 Platten – 1954 Zwickau
Wovon stammt der Mensch ab!
(Wu stammt der Mensch oh!)
Die schmutzigen Füße
(De drackiten Pfuten)
Die Fanni
(De Fanni)
ARTHUR GÜNTHER
1885 Schneeberg – 1974 Schneeberg
Helmut Ziehnerts Weihnachtsberg
(Ne Ziehnert-Helm sei Weihnachtsbarg)
STEPHAN DIETRICH (Saafnlob)
1898 Eibenstock – 1969 Hohenlimburg
Wo nichts rein kommt...
(Wu nischt neikimmt...)
Die fette Sau
(De fette Sau)
Der große Durst
(Dr gruße Dorscht)
Es hat ein Uhr geschlagen
(´s hot ans geschlogn)
Das hilft auch nicht
(Dos hilft aah nett)
Der letzte Hammerschmied
(Dr letzte Hammerschmied)
Die Kirchensteuer
(De Kirchnsteier)
Der Barbier (Friseur)
(Dr Balwier)
Das bisschen Musik
(Is bißl Musik)
Der Baß
(Dr Baß)
Der kalte Kaffee
(Dr kalte Kaffee)
Stöckraustu
(Wurzeln/Stöcke von abgesägten Bäumen ausgraben)
Das Weihnachtsbäumchen
(Is Weihnachtsbaaml)
Die Weihnachtsgans
(De Weihnachtsgans)
HERBERT KÖHLER
1906 Limbach – 1982 Limbach-Oberfrohna
Ein Heinzelmännchen von heute
(E Heinzelmannel von heitzetoge)
KARL HANS POLLMER (Geyer)
1911 Herold – 1974 Dresden
Meine Mutter
(Mei Mutter)
GUIDO WALTER FINDEISEN
1903 Wünschendorf – 1986 Lengefeld
Ein einträgliches Geschäft
(E eiträgliches Geschäft)
Eine furchtbare Rache
(Ene furchtbare Rach)
Ein gutes Rezept
(E gut Rezept)
Familien-Tragödie
(Familgen Tragödie)
Dreierlei Tee
(Dreierlaa Tee)
Kuss-Raten
(Schmatz-Rooten)
GOTTHARD B: SCHICKER
1946 Annaberg
Alles für die Katze – Eine Weihnachtsgeschichte aus dem Erzgebirge
(Alle fer de Katz)
Nachwort
Erzgebirgische Mundart ins Hochdeutsche übertragen
 |
Vorwort
Wissen Sie was der Erzgebirger meint, wenn er solche Wortungetüme wie „hiimundriim“ oder „hümundrüm“ oder „hüm un drüm“ von sich gibt oder gar aufschreibt? Ganz einfach: „hüben und drüben“ oder „auf beiden Seiten“ heißt das in seiner Sprache. Auch das Wort „fedder“ und „feeder“ wird Ihnen in der Mundartliteratur als das Hochdeutsche „weiter“ oder „vorwärts“ begegnen. Nicht gewusst? Und was fangen wir mit dem Wörtchen „fei“ an, wenn man es hier oben im Gebirge antrifft? Es kann bei dem einen für „aber“ oder „endlich“ stehen, doch beim anderen Mundartschriftsteller nach den deutschen Vokabeln „nämlich“, „ziemlich“ oder „freilich“ verlangen. Und fällt Ihnen zur erzgebirgischen „Seechams“ etwa „Ameise“ ein, denken Sie bei „Huchtsch“ an die „Hochzeit“, bei „Zerwands“ an das Akkordeon, bei „Gudsager“ an den Gottesacker oder Friedhof, beim Wort „Hitsch“ etwa an die Fußbank? Und wussten Sie, dass das hochdeutsche Serviertablett oder Hintragbrettchen man hierzulande „Hiidrabradl“ oder „Hierachbraddl“ spricht und schreibt?
Damit Sie nicht nur unsere eigenartige Sprache besser verstehen, sondern auch das, was sie in ihren Geschichten, die hier Schnorken und Schnurren genannt werden, ausdrückt, habe ich versucht, diese Übertragungen aus dem Erzgebirgischen in das Hochdeutsche anzufertigen.
Mir ist klar, dass ich damit einerseits ein Sakrileg der Erzgebirger angreife und mich der Kritik meiner Landsleute aussetze. Andererseits wäre es aber ein gewisser Verlust für alle Freunde des Erzgebirges aus nah und fern, wenn die heiteren Geschichten meines Bergvolkes – dieser Mutterwitz aus dem Vaterhaus - noch weitere Jahrzehnte nur von einem immer kleiner werdenden Kreis von Mundartkundigen genossen werden können. Dabei weiß ich natürlich, dass diese hier übertragenen und kommentierten Texte ihre einmalige und auch einzigartige Wirkung erst in der Mundart voll entfalten können. Aber das schließt nicht aus, dass man ihre Inhalte, ihren Humor, ihren Mutterwitz und ihre Lebensweisheiten durch diese Übertragungen (nicht Übersetzungen) einer größeren Leserschaft nahe bringen sollte, als das bisher der Fall ist. Vielleicht wird ja dadurch auch der eine oder andere angeregt, sich mit dem Original zu befassen. Diese Texte sollen aber insbesondere dazu dienen, einen wunderschönen, aber noch immer unterbelichteten Landstrich im Osten Deutschlands einer breiten Leserschaft etwas näher zu bringen. Diese Texte sollen auch dazu anregen, sich vor Ort selbst von den Menschen, ihrem Leben, ihrem Humor und ihrer Sprache einfangen zu lassen.
Gotthard B. Schicker
Kleiner Hochzeit-Wurm (in alterzgebirgischer Mundart)
... wenn fluksch der Napper drauff das huschte Ferckelthier /
dos fettste Schweinel sätzt / hä gessen nett derfür /
nän / werlich gotz / er triffts. Er wiebt en annern wühl
wos Hertz in Loibe hoht / dosselbe gie umb buhl
sich äne Sittiche. Er krieckt sä / glättmers mier
sex Wuchert an en stück / wie van getripten Bier
wehls assene Pfütze sieht / dos macht en silchen Lärm
in seiner Lederhuß / als epper Must und Gärm
un latter Naumersch Bier zesamm gesuffen hett /
do nempt üch eppes drauß. Jen bissel is zeffett.“
So endete der älteste bisher bekannte Text in alterzgebirgischer Munart. Der Verfasser ist nicht bekannt. Von ihm könnte auch ein „Ehren-Gedicht“ stammen, das 1660 entstanden ist und mit „Nicol der Schürrmäster Zu Schneppendorf“ unterzeichnet ist. Um 1930 hat der Direktor der Zwickauer Ratsbibliothek, Prof. Dr. phil. Otto Konstantin Clemen, diesen „Kleinen Hochzeits-Wurm“ vom 16. August 1659 unter einer Vielzahl von alten Dokumenten gefunden. Otto Clemen wurde am 30.12.1871 in Grimma geboren und er starb am 9.5.1946 in Zwickau. Bekannt wurde er auch als Forscher und Publizist zur Sächsischen Reformationsgeschichte. Er lehrte an der Theologischen Fakultät der Leipziger Universität Kirchengeschichte. Seinen Fund übergab er zur weiteren Auswertung an den damaligen Mitarbeiter der Ratsbibliothek, Otto Philipp, der das Hochzeit-Gedicht zur Veröffentlichung für die „Glückauf“-Zeitschrift vorbereitete. „Wurm“ wird der Text deshalb genannt, weil er auf schmalen langen Blättern gedruckt und vorgetragen wurde.
Bevor die Hochdeutsche Übersetzung folgt, soll der ausführlich Titel des Textes genannte werden, der weitere Informationen zu Herkunft und Anlass enthält: „Hochzeitliche Ehren – Gedancken / als der Ehrenveste / Vorachtbare und Wohlgelahrte / Herr Andreas – Jacobus Mavius / Medicinae Practicus zu Zwickau / sein Hochzeitliches Freuden-Fest mit der Erbarn / viel Ehr- und Tugendreichen Jungfrauen Rebeccen / Gebornen Rohrlapperin / Zu Glauchau in der Schönburgischen Herrschaft den 16. Augusti / 1659 begangen und celebriret / auffgesetzt und übergeben / und deshalb gedruckt Bey Melchior Göpnern.“ 
Die Unterschrift „Panekratzius Ortband / Erbsasse von Hintenzu“ ist natürlich vom anonymen Spaßvogel frei erfunden. Der Text aus dem Alt-Erzebirgischen kann nicht linear übertragen werden, da er sonst unverständlich wäre. Deshalb wird hier eine sinngemäße Übertragung angeboten, die sich weitestgehend am Original orientiert:
“Man soll etwas Bedeutendes sagen, wenn einer eine nimmt,
das etwas Gelehriges ist, wenn alle zusammentreffen,
bringt ein paar Verslein mit und wünscht gutes Glück,
als ob es die Braut nicht gäbe, das Rabenstück?
Mein Bräutigam will mich auch noch zu diesen Hundstagen tragen.
Nun bin ich wohl sein Onkel und mächtiger Graf,
aber er hat mehr, ich weiß nicht wie das kommt.
Hab mir mit ähnlichen Gedichten das Maul schon verbrannt.
Was schadet es, ich mache es für mich.
Da es eben jetzt mit der Amtsfuhre gebracht wurde,
so komm ich unverhofft dazu, wie das Mädchen zum Kinde.
Oho, es wäre mir bald entwischt! Verzeiht es mir! Lasst es geschehen,
nehmt es mit, es kostet mich nichts.
Der gute Bräutigam hat sich stattlich ausgestattet, trifft den Pflock,
hält ihn wohl, bekommt Feuer für die Spähne.
Wir Bauern grüßen ihn vom Dorfe Vogelherd.
Er bekommt einen Engel, sie ist sehr lobenswert.
Er kann nichts daran ändern, es ist ihm so beschert,
sein Leben hat er nun so eingerichtet.
So hab ich nun gehört von Talern, Gold und Geld
davon wird das Herz gestärkt, sehr wohl!
Der Schelm hat gemerkt, dass er in ein wohlhabendes Haus geheiratet hat.
Ich weiß wohl, was sie besitzt. Sie hat etliche hübsche Pfennige,
bisweilen ist sie stur, bisweilen aber auch zugänglich.
Oft lacht das Rabenfleisch, oft weit das arme Ding,
bald stirbt sie bald vor Liebe, bald spricht sie wieder ein wenig,
zuzeiten ist sie gut, zuzeiten ist sie wohl böse und komisch zu den Mädchen,
bald gibt es vollends Stöße wenn er einen Topf zerbricht.
Nachts schläft sie und schnarcht, am Tag nicht immer ist sie ein solcher Schatz.
Wenn schnelle der Nachbar dann das schöne Ferkeltier
das fetteste Schweinchen gegessen hat, wahrlich Gott, er triffts.
Es lebt er andere wohl, der ein Herz im Leibe hat,
der geh und hole sich eine solche Frau. Er bekommt sie, glaubt es mir,
sechs Wochen am Stück, wie Tröpfelbier, wenn es aus einer Pfütze sieht.
Das macht einen solchen Lärm in seiner Lederhose, als wenn er Most und Hefe
und lauter Naumburgisches Bier zusammen gesoffen hätte.
Da nehme ich etwas daraus. Jedes bisschen ist zu fett.”
* * *
Heinrich Köselitz (Peter Gast)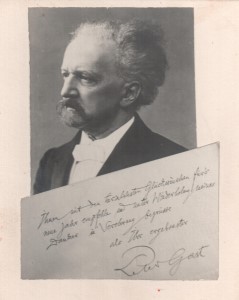
Heinrich Köselitz (* 10. Januar 1854 in Annaberg; † 15. August 1918 ebenda; besser bekannt als Peter Gast) war ein deutscher Schriftsteller und Komponist. Bekannt ist er als langjähriger Freund und Mitarbeiter vom Philosophen Friedrich Nietzsche. Aus: „Verwerrtes Volk“ (Annaberg, 1893)
Der Besenbinder
(Dr Baasnbinder)
Wenn unsereiner auf einem Berg steht, über sich den Himmel, unter sich die ganze Herrlichkeit – die Städte, Flüsse und Wälder und kleinere Berge –, da kann man sich manchmal nicht fassen vor lauter Lus, man muss die Arme ausbreiten und schreien, oder ein paar Wörter reden, oder gar einen Purzelbaum schlagen. Andere zeigen ihre Freude wieder anders. Der eine schaut runter wie ein Betbruder, der andere wie ein General, der Dritte wie ein Affe und der Vierte gar wie ein Geschäftsmann. Dabei fällt mir der Bermsgrüner Besen-Traugott ein. Als der den Besenhandel damals begann, ging er mit den Besen auf dem Rücken hausieren; später legte er sich einen kleinen Handwagen mit einem Hund vorn dran zu. Später konnte er sich sogar einen Leiterwagen mit einem Pferd anschaffen. „Nun werde ich gleich nach Leipzig fahren“, dachte er so bei sich und machte sich auch auf den Weg mit einem ganzen Wagen voll Besen über Schwarzenberg, Grünhain, Zwöhnitz, Stollberg runter nach Penig und Borna bei Liebertwolkwitz. Als er dort auf die Anhöhe kam und in der Probstheider Gegend auf einmal das ungeheure Schlachtfeld sah, wo schon Napoleon Leipzig unter sich hatte liegen sehen, da wurde ihm ganz großartig um das Herz. Er hielt an, knallt mit der Peitsche, dass die ganze Plane in Fetzen ging, und schrie so laut wie er konnte: „Na Leipsch! - Wenn de Gald hast: Baasn sei do!“ - (Nun, Leipzig, wenn Du Geld hast, Besen sind da!).
Und hier einmal im Original:
Wenn uneraans of en Barg stieht: über sich ne Himmel, unner sich de ganze Harrlichkaat – Städt, Flüss un Waller un klennere Barg - , do ka mer sich mannichsmol net losen ver Lust, mer muß de Händ ausbraaten un schreie oder e paar Wörter reden oder gar enn Porzelbaam schlogn! Annere tunne sich wieder annersch aus in ihrer Freed. (…) Do derbei fällt mer dr Barmsgrüner Baasen-Traugott ei. Wie daar ne Baasenhannel afing, ging er mit´n Baasn of´n Buckl hausiern; spöter er sich es Waagel mit enn Hund zuOf de Letzt kunnt´r sich sugar enn Letterwogn un e Pfaar aschaffen – su tat sei Hannel flacken! “Nu wird oder gelei bis of Leipzig gefahrn!“ sat er do bei sich un machet aah richtig mit enn ganzen Fuder Baasen über Schwarzenbarg, Grühaa, Zwänz, Stollbarg nei nooch Penig un Borne bis Liebertwolkwitz. Wie er nu dorten de Ahöh nausgelästert kam un in dr ProbsthaiderGegnd of aamol dos ugeheire Schlachtfald sohch, wu schu dr Napolion hatt Leipzig unten liegn saah, do wur´sch ne ganz grußartig üms Herz rüm. Er hielt a, knallet mit dr Peitsch, doß de ganze Schmitz in Franzen ging, un schrier, wos zun Maul raus kunnt: “Na Leipsch! – Wenn de Gald hast: Baasen sei do!“
Einem geschenkten Gaul...
(Enn geschentn Gaul...)
Als der Kanner Martin seine Goldene Hochzeit feierte, haben alle zusammen – der Pastor, der Oberförster, der Klenke vom Rittergut und alle Bauern – ihm eine kleine Orgel geschenkt. Die stellte der Martin in seine Gute Stube rein. Wenn er dann im Sommer die Fenster offen hatte und man hörte durch den Birnbaum wie er spielte, da blieb man stehen und horchte zu. Es klang so schön, wie vom Himmel runter...!
Nun besuchte ihn einmal ein junger Schulmeister, ich weiß aber nicht woher der kam. Dem zeigte der Martin auch seine Orgel, spielte darauf etwas vor und ließ ihn danach auch mal selber spielen. Da sagte der Schulmeister: „Also, gar so viel kann ich an der Orgel nicht finden. Da gibt es schon bessere in der selben Größe.“ Also, nun hört es sich aber auf, sagt der Martin. Ich habe meine größte Freude daran und ihr wollt die gleich wieder zerstören. Das ist aber egal, ich mach mir einfach nichts daraus. Aber ein Geschenk bemängeln, das ist gar nicht passend. Wer noch mal mit so einer Bemerkung kommt, dem sag ich ganz einfach: „Ener geschenktn Orgel sieht mr net in dr Gorgel!“ (Einer geschenkten Orgel sieht man nicht in die Gurgel!)
Wurst gegen Wurst
(Worscht wider Worscht)
Den Fleischer Krumbholz in der Schmalzgasse habt ihr bestimmt noch gekannt. Der hängte mal, wie man es früher so machte, gleich eine ganzen ausgeschlachteten Ochsen draußen an die Tür. Und weil nun nicht die ganze Zeit jemand dabei stehen konnte, der aufpasste, geschah ihm doch das Malleur, dass der große Hund vom Advokat Wolcher dem Ochsen eine ganzen Happen Fleisch aus dem Genick raus fraß. Der Krumbholz musste schon so was ahnen, denn er dachte, willst nur mal raus schauen. Und da sah er die Bescherung! Und sah auch, wie der große Hund gerade unten um die Straßenecke schwenkte.
„Na warte nur, diesmal setzt es was!“ Und dabei kollerten seine Augen, dass man es ordentlich hörte. Am selben Tag um diese Zeit, als man die Laternen anbrannte, geht der Advokat Wolcher dort vorbei. Der Krumbholz sah ihn schon von Weiten kommen. „Gehorsamster Diener, Herr Advokat“ sagte er ganz freundlich „ich möchte Sie mal was fragen: Wenn einem ein Hund von einem fetten Ochs ein Stück Fleisch runter frisst, wer muss denn danach dafür einstehen?“
„Nun allemal der Herr von dem Hund, das weiß man doch.“
„Mir hat nämlich so eine Bestie heute Vormittag ungefähr drei Pfund davon runter geschnappt.“
„Da schreiben Sie ganz einfach die Rechnung und schicken sie dem Betroffenen zu.“
„Na, dann ist es ja gut, dann werde ich das so machen. Guten Abend, Herr Advokat!“
Wie der Laden zugemacht wurde, setzte sich der Krumbholz hin und schrieb an den Wolcher eine Rechnung über die drei Pfund Rindfleisch, die sein Hund von dem Ochsen runter gemaust hatte. Damals kostete das Pfund Rindfleisch noch sechs Groschen: das machte demnach im Ganzen achtzehn Groschen. Am nächsten Morgen schickt er die Rechnung mit seinem Lehrjungen hinüber.
Als der Advokat den Zettel gelesen hatte, geht er ans Schreibpult und setzt noch darunter: „Einen juristischen Rat erteilt, macht einen Taler, bekomme ich also noch zwölf Groschen raus.“ So was hatte der Krumbholz nicht vermutet. Aber er musste es bezahlen, da half alles nichts. Da suchte er aus einem Kästchen lauter Geld, das niemand mehr annehmen wollte und ließ dem Advokaten ausrichten: „Wenn es ihm lieber wäre, könnte er sich für die zwölf Groschen auch zwei Pfund Fleisch wegholen. Der Bequemlichkeit wegen hätte er den Ochsen schon draußen aufgehängt“. Womit er meinte: Wolscher, Du bist auch ein Hund...!
Der Hammerschmied
(Dr Hammerschmid)
Der alte Kilian, das war auch so ein Original. Solche Leute gibt es immer wieder. Im Augenblick fällt mir nur die Antwort ein, die er einmal unsrem Herrn Pastor gegeben hatte. Als nämlich der Hammerschmied Kilian so in die Jahre kam, fiel ihm das Laufen immer schwerer. Deshalb setzte er sich am Nachmittag, wenn das Wetter schön war, unter die große Linde und rauchte seine Pfeife vor sich hin. Da kam der Pastor mit einem anderen Kirchengängern dort vorbei, ich glaube es war eine Taufe, und fragte ihn: „Nun, wie geht’s denn, Kilian?“ „Ach, Herr Pfarrer, es will halt gar nicht mehr richtig gehen! Da hab ich nun dem lieben Gott mein Lebtag lang um einen gesunden Leib gebeten, und hab doch dabei die Beine vergessen!“
Versprochen
(Verplappert)
Der alte Kilian aus dem Frohnauer Hammer hatte die Hunde gern. Wo er ging, da lief auch sein kleiner Spitz um die Lederhosen herum. Einmal musste er wegen einer dummen Geschichte, bei der sie nicht Recht geben konnten, nach Wolkenstein ins Mühlenamt. Er war kaum drinnen in der Gerichtsstube, da rennt sein Spitz hinter die Regale, schnuppert an den vielen Akten herum und hebt auch gleich das Hinterbein hoch. „Gschscht! Wirst Du gleich dort weg gehen“, schrie der Schreiber. „Ach, lassen sie ihn nur. Was einmal beschissen ist, kann auch beschifft werden!“ Diese Worte bekamen dem Kilian aber schlecht. Er musste fünf Taler dafür zahlen.
Das Rechen-Exempel
(s´ Rachn-Exempl)
Gestern Abend erzählte der Schulmeister, er hätte in der Rechenstunde den Jungen vom Nachtwächter Bittner gefragt, wie viel raus kommt, wenn man zwei von zehn abzieht. Der Junge wusste keine Antwort, er sagte nichts. Nun wollte es ihm der Schulmeister etwas deutlicher machen und sagte: „Wenn Dich Deine Mutter mit zehn Pfennigen zum Bäcker schickt, du sollst für acht Pfennige Semmeln holen – wie viel bekommst du denn dann da raus?“ „Nichts!“ - sagt er - „wir borgen!“
Und dieser Text noch einmal in erzgebirgischer Mundart:
´s Rachn-Exempl
Gestern ohmst drzehlet dr Schulmeester, ´r hätt´ in dr :Rachnstund´ ne Nachtwachter Bittner senn Gung gefregt, wieviel rauskimmt, wemmer zweä vu zaahne o´zieht. Daar Gung wusst´ käne Antwort; ´r muckset net. Nu wollt´s ne dr Schulmeester ä bissl deitlicher machen un saht´: „Wenn Diech die Muter mit zaah´ Pfeng´ zon Beckn schickt, de sölst fr acht Pfeng Sammln hul´n – wieviel kreigste de dä´ do raus?“ „Nischt!“ - saht´ ´r – mr borng!“
Paukers Weisheit
(Paukenschleger-Weisheet)
Die Schulmeister aus dem ganzen Erzgebirge hatten einmal eine große Versammlung in Chemnitz. Sie wurden dort gefeiert, als wenn sei lauter Könige wären. Großer Empfang am Bahnhof, Essen, Reden, Konzertmusik, Ausflüge, Konferenzen – das ging nur so durcheinander: Wir wussten gar nicht mehr, was die Hauptsache und was die Nebensache war. Am letzten Tag wurde sogar – extra für die Schulmeister – im Theater „Don Juan“ (erzgeb.: Dongschewang) gegeben. Als nun die Musikanten gestimmt hatten und es bald los gehen sollte, drehte sich der Paukenschläger Kraft einmal herum, nahm eine Priese aus der Schnupftabakdose und schaute sich die Leute an. „Na, altes Würbeltier?“ fragte sein Nachbar der Brummbass-Fischer, und griff auch mit in die Dose rein. „Was wunderst Du Dich denn so, es sind dir wohl nicht genug Leute im Theater?“ Also, voller wie heute hab ich das Theater schon gesehen, manchmal auch leerer. Aber so voller Lehrer wie heute, hab ich es noch nie gesehen“:
Die Teich-Türe
(De Teich-Thir)
Neulich ging ich in Annaberg paar Meter von meinem Haus am Teichdamm entlang. Da kam eine Gruppe kleiner Jungen mit dem Schulmeister. Dieses und Jenes zeigte und erklärte er und manchmal fragten sie auch dazwischen. Alle guckten durch den Zaun in den Teich und der Schulmeister redete nur vom Wasser, wie es im gewöhnlichen Zustand die Flüsse, Teiche und Meere bildet und wie es bei größerer Wärme in Dampf, Nebel und Wolken übergeht, und wie es bei richtiger Kälte sogar hart und zu Eis wird. Dann fragte er den Sohn vom Mörschelmeyer. „Nun, Kleiner, sag einmal, warum man also im Winter auf dem Teich herum laufen kann?“ - Was denkt Ihr denn, was der Junge darauf antwortete? - „Weil die Teich-Tür offen ist“, sagte er.
Der unselige Schornstein
(De unsaalche Feiereß)
Vor dem Brand von anno 1637 sah unser Annaberg etwas anders aus als jetzt: Schindeldächer, hölzerne Feuer-Essen, Fachwerk mit Lehm verschmiert, die Treppen aus Holz – solche wackeligen Buchten nannten sie damals Häuser, es waren aber meistenteils nur Hütten. Da stand dort, wo jetzt der Schutzteich ist auch so eine baufällige Hütte. Sie hieß nur die „Tyrasburg“. Dort wohnte der Büchsenmacher Lurich, ein ehrlicher Mann, der sich sein bisschen Brot sauer verdiente. Wie es nun früher so in den Schmieden und Schlossern so war – er hatte keine Esse. Der Rauch ging oben zur Dachluke hinaus, aber deswegen passierte nichts Nun kam aber nun die Verordnung heraus, steinerne Feueressen zu haben. Unser Lurich dachte, das lass ich mal sein. Ist es bis jetzt gut gegangen, wird es auch so weiter gehen. So dachten aber der Bürgermeister nicht. Wie er sah, dass der Lurich keine Anstalten zum Essenbau machte, schickte er einen Wachmeister zu ihm und ließ ausrichten: da muss eine Esse gebaut werden! Es gehe beim besten Willen nicht anders. Aber so schnell machte das der Lurich nicht, da musst der Wachtmeister schon noch paar Mal kommen. Und zuletzt kam sogar der Bürgermeister selbst. „Lurich“ - sagte der - „wann wird es denn nun endlich? Sie kommen auch nicht an den Essenbau vorbei. Die Esse muss her! Da beißt die Maus keinen Faden ab. Bin ich es etwa, der die Gesetze macht? Wenn Sie es nicht bald machen, sollte es mir leid tun, dass ich dann zu anderen Maßregeln gegen Sie greifen müsste!“ Da ließ sich der Lurich endlich eine steinernen Esse einbauen. Das war im Februar 1637. Vier Wochen später, es war der 29. März früh um halb Zehn - ich weiß es noch wie heute – läutete auf einmal das Elfuhrglöcklein (Elfgelöckl) und die große Glocke stürmisch. „Feuer, Feuer!“ „Wo denn?“ - „Auf der Siebenhäusergasse!“ Oh, du großes Elend, dachten alle, bei dem Sturm ein Feuer! Oh, Gott, wie wird das werden!? Und es wurde schlimmer, asl es sich ein Mensch vorstellen kann. Die von der Sommerleite waren herüber gekommen und wollten sich das Feuer ansehen. Doch da hieß es aber bald: „Geht schnell nach Hause, bei euch brennt es ja auch schon!“ Der Wind kam vom „Letzten Heller“ rüber, und weil es heller Tag war, sah man nicht, wie die Funken und glühende Schindeln durch die Luft fort flogen. Kurzum, es dauerte keine Stunde da stand auch das ganze Partikel Häuser beim Meisterhaus vorbei, die Große Kirchgasse hinauf, über dem Neumarkt hinüber bis zum Scharfrichter seinen Turm – in Flammen. Über 150 Häuser brannten damals weg. Wie nun gegen Abend die Glut nachließ und die Leute wieder in den Feuerherd hinein konnten, ging auch der Lurich dort hin, wo sein Häuschen gestanden hatte. Da hätte man gleich heulen mögen, wie er so in die verkohlten Balken und und in den Qualm rein stierte und danach wieder zu der schönen Esse hinauf sagte, die kerzengerade alleine da stand. Es war ihm wie weinen und lachen zugleich. Lieber hätte er allerdings ein Donnerwetter los gelassen: „Konnte ich denn nicht noch ein wenig warten mit der Esse? Das haben wir nun von der ewigen Quengelei!“ - dachte er so bei sich und dachte auch an den Bürgermeister. Der ging gerade persönlich mit paar Herren hier vorbei. „Nun sehen sie, meine Herren“ - platzte es aus dem Lurich heraus - „Was nützt mir jetzt die schöne Feueresse. Erst hatte ich ein Häuschen und keine Esse, aber jetzt – Jetzt hab ich ne Esse – und kein Häuschen!“
Ein großes Bündel Heu
(Ä gruß´ Bündl Hei)
Dazu muss zunächst erklärt werden, dass ein „Bündel Heu“ in der Fuhrmannsprache ein Butterbrot mit Käse bedeutet. Köselitz schreibt dazu „Es zeugt von humaner Herablassung und Selbstironie in der Thierliebe der erzgebirgischen Fuhrleute, daß sie dies Essen, das sie im Wirtshaus gewöhnlich einnehmen, während ihre Pferde draußen fressen, mit dem selben Namen belegen, den das Rast-Futter ihrer Thiere hat.“ Aus der Fuhrmannssprache ging der Ausdruck „Bündel Heu“ (Bündl Hei) in die allgemeine Wirtshaussprache des Erzgebirges ein.
Früher bekamen die Budenleute immer zu essen, wenn sie gegen Mittag zu den Kaufleuten herum kamen. Hatten sie dann mit der Zeit mitbekommen, wo es die besten Bissen gab, richteten sie sich so darauf ein, dass sie dort jedes mal so gegen zwei Uhr hin kamen. Der Kaufmann Emmerich in der Wolkensteiner Gasse war einer, der ihnen jedesmal Suppe, Brot und Gemüse gab und auch noch ein Kümmelfleisch hinsetzte. Bei ihm hatte auch jede Woche der von der Eibenstocker Bude zu tun – Traugott hieß der. Einmal der viel später als gewöhnlich zu ihm, weil er anderswo hatte länger warten müssen. „Ach, Gott!“ sagte da der Emmerich, „das tut mir aber leid, wir haben alles aufgegessen... Oder warte mal etwas, wir werden gleich Rat wissen! - Du, Emma (sagte er rasch zum Dienstmädchen), geh doch mal rüber zum Kaiser und hole Emmenthaler Käse wie gewöhnlich. Haste gehört? Emmenthaler Käse!“
Emma geht rüber zum Tütenkrämer und sagt: „Ich möchte Emmenthaler Käse.“ - „Wieviel hast Du gesagt, mein Schätzchen?“ fragt der Kaiser. Die dumme Gans ruft darauf hin ganz patzig: „Emm-en-thaler-Käääse!, ich meine Emmenthaler Schweizer Käse! - Machen Sie nur schnell, sonst bekomme ich zu Hause Ausgeschimpftes!“ Das fuhr den alten Gaalob in die Nase und in alle Glieder; er murmelte herum wie ein Fliege an der Fensterscheibe, holte das große Messer, einen Laib Käse, überlegte sich es noch einmal: „Emm..en..thaler Käse?! Soll das richtig sein? Aber ragen werde ich das zickige Mädchen nicht noch einmal. Es wird schon so sein!“ - und schnitt einen Thaler (das waren damals vier Pfund Käse) herunter, legte das Stück auf die Waage, und weil es ewig nicht stimmen wollte, musste er noch ein paar kleine Stücke mit drauf legen. Danach packte er ihn in gelbes Strohpapier ein, gab das Päckchen der Emma und schrieb den Thaler Käse in ihr Büchlein, denn beim Emmerich ging alles auf Rechnung.
Wenn beim Emmerich die Haustüre auf- oder zugeht, dann klingelt es jedes mal: wie also die Emma wieder nach Hause kam, hörte das der Emmerich. Er war in den ersten Stock hinaufgegangen und hatte die „Eibenstocker Bude“, als er ihn abgefertigt hatte, inzwischen unten in die Stube rein gehen sehen. „Emma!“ rief Emmerich runter „leg nur den Käse auf einen Teller und stell ihn dem Buden-Traugott hin! Vergiss auch das Brot, die Butter und das Kümmelfleisch nicht. Sag ihm nur, ich komme gleich runter und er soll inzwischen essen.“
Nach einer Weile kommt der Emmerich ins Zimmer, wo der Traugott sitzt. Er sieht ganz verwundert den gewaltigen Würfel Käse, den der da vor sich hat. Aber nachzufragen, warum das Mädchen so viel Käse geholt hat, vergaß er gänzlich. Und er dachte, wenn der Traugott genug hat, wird er bestimmt aufhören zu essen. So ging er also in der Stube hin und her und redete manchmal auf den Traugott ein. Der ging aber auf nichts ein und sagte immer nur „Ja!“ oder „So ist es!“ oder „Ist denn das die Möglichkeit!“ Für ihn gab es nichts anderes, wenn er erst mal beim Essen saß – da schwiegen alle Flöten. So schnitt er sich eine Scheibe nach der anderen ab, aß tüchtig Brot dazu und war auch beim Kümmel-Einschenken nicht faul. Na, wenn das so weiter gehen soll, da muss es meinem Emmerich Angst und Bange werden (es lag ihm nämlich viel am Schweizer Käse)! Darum dachte er, willste nur ein bisschen mit der Zaunslatte winken. „Du, Traugott“, sagte er „der Käse ist teuer!“ - „Weiß schon“ meinte der „er schmeckt aber auch danach!“ und dabei schnitt er sich wieder eine Scheibe Brot (Bemm) ab, schmierte die Butter fingerdick darauf und fraß weiter wie ein Scheunendrescher. Mein Emmerich verlor immer mehr seine Ruhe. Nach einer Weile sagte er: „Du, Traugott, von dem Käse darf man nicht zu viel essen, sonst wird man krank.“ - „Mir macht er nichts!“ sagte der Traugott, „später lauf ich ihn mir schon wieder raus!“ - und dazu wieder einen Kanten Brot, ein großes Stück Käse, abgesägt, und weitergemampft und -gekaut, dass die Schwarte kracht. Nun trat dem Emmerich der Angstschweiß auf die Stirn. „Traugott, Traugott! - ich mach mir große Sorgen um dich! Wenn man zu viel Käse ist, dann geht der ganze Magen in Würmer über und die fressen nach und nach den ganzen Menschen auf!“ - „Ach, glauben sie bloß nicht solches Zeug! Das haben sie sich doch nur die ausgedacht, die den Käse gern selber essen.“
Oh, Himmel an der Wand! Was soll nun mein Emmerich tun?! Wegnehmen wollte und konnte er den Käse nicht. Und der Heuochse dort – das sah man schon – hat es darauf abgesehen, das alles alle wird: Käse, Brot, Butter und Kümmel. Drei Pfund Emmenthaler muss er schon runter haben. - Da schwoll endlich meinem Emmerich der Kamm und er sagte fuchsteufelswild: „Traugott!! Jetzt hör aber mal auf mit der Fresserei! Du ruinierst dich nur und fällst mir zum Schluss gar noch tot von der Stange! Ich mag keine Leiche im Haus!“ - „Herr Emmerich! Was sind das für Reden?! Da vergeht einem ja der ganze Appetit! Wenn sie aber meinen, der Käse könnte mir schaden, nun da will ich aufhören und das Stück meiner Frau mitnehmen!“ Daraufhin zog er aus der Seitentasche einen zusammengeknüllten Bogen Packpapier, machte es auf dem Tisch glatt und packte das letzte Pfund Käse ein: „Adjeu, Herr Emmerich! Und schönen Dank für das Essen! Das es nun heute nichts warmes mehr gab, darüber müssen sie sich keine Sorgen machen. Wie sie sehen, nehme ich auch mal mit einem Bündel Heu vorlieb. Leben sie recht wohl!“
Nun, die letzten Worte sagte er schon fast draußen auf der Gasse, denn der Emmerich, der ordentlich vor Wut kochte, schob ihn mehr raus als dass er ihn raus führte. Danach schmiss er die Türe zu und wetterte drinnen weiter, dass es durchs ganze Haus schallte. Vierzehn Tage später zog die Emma fort. Und acht Tage danach, als der Traugott zu Mttag wieder kommen wollte, fand er ein ganz neues Schild angeschlagen wo drauf stand: „Von halb Zwölf bis um Zwei geschlossen.“
Stoßseufzer eines Crottendorfer Räucherkerzchenjungen im Winter
(Stußseifzer von enn Kruutnderfer Räächer_Kerzl-Gung in Winter)
„Wenn iech neer de Finger drfriern thät´! ´s wär´ menn Voter schu racht! Worim kaaft´r mr käne Handsching!!“
Wenn ich mir nur die Finger erfrieren würde, das wäre meinem Vater schon recht! Warum kauft er mir keine Handschuhe!!“
Die Texte entstanden zwischen 1896 und 1900.
* * *
Fritz Körner
Friedrich Leberecht Körner, genannt Fritz, wurde am 28. April 1873 in Waschleithe als Sohn eines Bergmanns geboren und er starb am 15. Juli 1930 in Beierfeld.
Nach dem Besuch der Volksschule in seinem Geburtsort wurde er Bürolehrling im Rathaus von Grünhain. Später erlernte er einen kaufmännischen Beruf, wurde Prokurist und war zuletzt als selbstständiger Kaufmann tätig. Er war lange Zeit krank, und da sein Geschäft nicht gut ging, lebte er in den letzten Jahren in großer Armut. Bereits frühzeitig schrieb er ernste und heitere Geschichten und Gedichte sowie zwei Theaterstücke in erzgebirgischer Mundart, in denen er versuchte, das Typische dieser Landschaft und deren Bewohner darzustellen. Er schöpfte dabei stets aus seiner unmittelbar selbst erlebten Umwelt. Seine Texte unterscheiden sich hinsichtlich der sprachlichen Qualität und der literarischen Substanz positiv von den üblichen Mundartgeschichten. Ungeschönt prangerte er dabei auch Missstände an, womit er sich nicht nur Freund schafft. So auch in der hier übertragenen letzten Arbeit, in deren Mittelpunkt der tote Gänserich „Nebegadnezer/Nebukadnezar“ (genannt nach dem spätbabylonischen König, 640 – 562 v.d.Z., „Werkzeug Gottes zur Bestrafung der Sünden“) steht. Darin bringt Fritz Körner 1930 seine große Enttäuschung über die Verhältnisse und das Verhalten seiner Mitmenschen zum Ausdruck. Es handelt sich hier auch um eine Auseinandersetzung mit der andauernden politischen Bevormundung des Sozialdemokraten Körner durch den damaligen national-konservativen Erzgebirgsverein:
Nebukadnezar
(Nebegadnezer)
Als ich meine Vieherde austreiben wollte: neun Kühe, vier Kälber, einen Brummochsen, zwei Schafe und drei Ziegen, sagte die Bachbäuerin: „Großer, heute hütet die Alma. Du gehst aber jetzt gleich auf den Nussberg zum Aktewar (Gerichtsschreiber, Advokat) Bock und trägst ihm unseren alten Nebegadnezer hin. Der ist heute Nacht gestorben, dort in dem böhmischen Tragannstkorb liegt er.“ „Der Nebegad ist so schnell gestorben? Was hat ihm denn gefehlt? Der war doch gestern noch gut auf den Beinen.“ „Der Zehma hat ihn mit dem Fleischerstecken erschlagen. Komm! Nimm den Tragkorb auf den Rücken. Sag einen schönen Gruß an die Frau Advokat, wegen des Preises käme ich schon mal vorbei. Und wische dir die Nase, bevor du rein gehst. Und sage danke schön, und bedanke dich auch, wenn du was zu Essen bekommst. Und wenn dir eventuell der Herr Advokat ein Schwanzgeld gibt, teilst du es mit der Alma. Und nun geh! Trödle nicht zu lange auf dem langen Weg, du musst heute noch die Hecke schneiden, und sollte ich noch Krautköpfe rein holen, musst du heute auch noch ein Fässchen Sauerkraut eintreten.“
Die Bachbäuerin ging ihr Wege und ich legte den toten Nebekadnezer im Tragkorb zum alten Advokaten Bock schleppen. Der alte Advokat war sehr reich und war ein ganz (lapperfötzlicher) hinterhältiger Mann; der wird an dem Nebegadnezer eine große Freude haben.
Der tote Nebegadnezer war ein Gänserich. Den Spitznamen hatte er bekommen, weil er den Bäuerinnen die Pflanzen, den Salat, die Petersilie und die Blumen aus den Kleingärten weg fraß. Aber nicht aus Dummheit wie einst der biblische Nebegadnezar, nein, nein, aus purer Langeweile, aus reiner Unart, aus blitzblanker Wollust. In seiner Jugend war er mal ein ganz berühmter Gänserich gewesen. Er hatte den Bachbauerbennich (Benjamin Bachbauer), der ins Wasser gefallen war, so lange am Gaaferlatz (Geiferlätzchen, Latz am Hals kleiner Kinder) gehalten, bis die Bachbäuerin zur Hilfe kam. Und als sie nun ihren Benjamin vorn und hinten, oben und unten drückte und küsste, nahm der Bachbauer den Gänserich in den Arm und schrie: „Singt Floria und Gloria! Gänserich, verdammt noch mal, ich will Matz heißen – Mützmatz kannst du schreien – solltest du bei r kein ewiges Leben haben. Kinder, singt und schreibt euch tief ins Herz: Unser braver Gänserich wird nicht geschlachtet und auch nicht verkauft, der hat sein ewiges Leben bei uns!“
Sie haben nun auch wirklich gejubelt und Danklieder gesungen und haben auch Wort gehalten: Nebegadnezer ist in Ehren alt geworden. In großen, großen Ehren. Die Zeitungen haben über ihn geschrieben. Auf dem Jahrmarkt sangen die Bänkelsäner von seiner Tat. Und ein Männelmaler war gekommen und hat den Nebegad angemalt. Ja, der Nebegadnezer war in großen Ehren, aber selber war er kein Ehrengänserich.
„Der Kuckuck war ein feiner Mann, er schafft sich dreißig Weiber an!“ - sang man oft und gern. Und der Nebegadnezer war ein solcher Kuckuck. Hatte irgendwo ein junger Gänserich eine schöne, schneeweiße Gans zur Frau, zwickte und ärgerte der freche Nebegad ihn so sehr, bis er mit Jammergeschrei aus riss und sein schönes Gänselein, sein Herzgeblüt und Herzgespann, in Stich ließ. Auch sonst war er nicht gut angesehen. Die Gasthofkatze, die jeden Fleischerhund kratzte, wenn er sie anfiel, schlich sich an der Seite weg, wenn der alte Nebegadnezer kam. Und die schlimmsten Schuljungen, die den Herrn Vorstand, den reichen Sauma und den Herrn Bergverwalter kein einziges Mal grüßten, die lachten den Nebegadnezer freundlich an und sagten ganz kleinlaut: „Nezerle, wie geht’s dir denn?“ Am liebsten hätten sie auf den alten Dingerich (Kerl, fremder Mann mit zweifelhaften Ruf) einen großen Stein geschmissen. Aber Nebegad verstand einen Spaß: Wer nicht lieb zu ihm war, bekam Schnabelhiebe. Aber aus dieser Tyrannei wuchs die Zuchtrute, die den Nebegadnezer ums Leben brachte. Standen einmal drei oder vier Frauen wie angeleimt beieinander und zogen – in christlicher Art – über die Kölberlott (Lotte, die Kälber betreut) oder den Ochsendav (Gustav, der einen Ochsen besitzt) her, da trieb sie der reche Nebegadnezer auseinander. Hatte man mal eine neue Hose oder ein neues Hemd an und fand sich wichtig, und grüßte deshalb den Gänserich nicht, trieb einen der auf den Baum oder in den Bach rein. In Glanz und Gnade krabbelte man nun auf den Baum rauf oder plumste wei ein Frosch ins Wasser, aber in Schande und Ungnade kam man dann wieder auf festen Boden und nach Hause. Doch wenn dort nachher der Vater oder die Mutter den Birkengottfried (Besen aus Birkenzweigen), die Elle oder den Strick an einem ausprobierten wollten, sagte man: „Lasst mich nur heute, heute bin ich unschuldig, der Nebegad hat mich getrieben.“ Nun wurde der Vater ein Löwe und die Mutter eine Löwin und brüllten: „Wann wird denn dem Nebegad sein Sündenmaß überlaufen? Der müsste nicht Nebegadnezer – der erweckt doch zuletzt Reue im Leid – der müsste Judas, Herodes oder Holufernes heißen! Den Gänserich müssten sie mit Mistgabeln erstechen und mit Krauthacken erschlagen. Wenn es dem nicht rein kommt, - ich weiß nicht, was der liebe Gott manches mal für ein Mann ist.“
Manche Leute denken, der liebe Gott macht es wie der alte Förster aus Greiz, die die Kinder auf der Straße verprügelt. Ich habe aber heraus gefunden, dass er mehr dem Bortenmann aus Heide (Ort bei Schwarzenberg) ähnelt. Der hatte einen einzigen Jungen, den Karl und der Karl war ein großer Faulenzer, und was er klöppelte, war Schlunk (schlechte Arbeit). Aber einmal im Jahr, wenn sie richtig im Saft standen, da schnitt der Bortenmann Pfeifen-Gerten (Ruten) ab. Da sagte der Bortenmann zum Karl: „Heute werden wir mal vergleichen, wie unsere Rechnung steht.“ Und als nun der Karl in der guten Stube wie auf glühenden Kohlen saß, nahm der Bortenmann das Büchlein raus und las vor, was da drinnen stand. Lauter große, reife Sünden, die der schöne Karl begangen hatte, standen in dem Büchlein: Pfockensünden, Traumsünden, Sünden ganz rot und grell. Hatte nun der Bortenmann die vielen Sünden vorgelesen, griff er in die Hosentasche, holte sein Schnappmesser raus und sagte: „Da hast du mein Messer, geh mal ins Gestrüpp und hole mal paar recht schöne Pfeifen-Gerten, ich will dir Nachmittag ein paar Pfeifen und Flöten machen.“ Und der Karl ging. Und immer wenn er eine besonders schöne und glatte Pfeifen-Gerte fand dachte er: „Wird daraus nun eine Pfeife oder bekomme ich damit Pfiffe?“ Und da erwachte im schönen Karl Reue und Leid. Und als er nach Hause kam sagte er: „Vater, ich hab es eingesehen, ich habe nicht gefolgt. Da habe ich feste, schlanke Gerten mitgebracht. Verhau mich gnädig damit.“ Und wenn es paar Schläge gegeben hat, dann waren die doch gt und nützlich. Am Nachmittag aber saß der Bortenmann mit seinem Karl im Kleingarten und sie sangen:
„Kloppe, kloppe Pfeifel,
Maadel gieh ins Teichel.
Laaft se nort dos Bargel na,
hot se schwarze Fizschuh a.
Is mei Pfeifel ut geroten,
ass´mer morgn enn Schweinebroten.“
Oder sie bliesen Flöte und Pfeife.
Macht es also der liebe Gott wie der Heidener Bortenmann, so mach er es gut und richtig. Denn neunzig Prozent aller Sünden, die dem Nebegadnezer aufgeladen wurden, hatte er nicht begangen. Jeder Junge und jedes Mädchen schob die Schuld auf den armen Gänserich, wenn sie mal was ausgefressen hatten. Und als die Schuld haushoch geworden war, da hat der aufgehetzte Fleischer Zehma den Gänserich mit dem Gutentagstacken (Spazierstock) erschlagen.
Auch ich war ein solcher Lügenbeutel gewesen. Ich lag auch lieber am Bach als am Buch, saß lieber auf der Tanne als auf der Tenne und hatte an den fünf stinkenden Wiedehopfen auf der Saurrampferwiese mehr Freude als an den fünf frommen Schwestern Wiedehopp, die alle fünf nach Pech und Schwefel schrien, wenn ich ihre dreifarbene Katze ärgerte. Und als ich mir das alles so richtig überlegte, musste ich den böhmischen Tragkorb absetzen und meinen armen, toten Nebegadnezer anschauen. Da lag er nun, der große, stolze Gänsekönig. Geschlossen waren die Augen und der Schnabel, der sonst so gewaltig zischen konnte, und um den Kopf herum hatte der König ein Strohband, da war das Loch darunter, das ihm der Zehma geschlagen und die Bachbäuerin gestochen hatte. „Armer Nebegad! Guter Gänserich, hast mir so manchen Schlag erspart. Ich wollt, ich hätte sie jetzt und wir könnten miteinander im Oswaldbach herum plätschern und herum planschen und könnten Kraabisser (Krebse), Forellen und Kaulquappen fangen oder jagen!“
„Und prangen dein Sünden
wie rosenroter Klee,
musst du zuletzt doch finden
Arznei wie Koloquinthen
und bitterer noch als Aloen.
Sie ist gefallen, Babylon,
die stolze Stadt!
Und ihr unseliger König
Nebugad liegt vor uns im Staube!“, -
so jubelten zwei fromme Wiedhopp-Mädchen und schauten den armen König mit richtigen Nudelaugen an. „Und dir, Bursche, wird es nicht besser gehen“, sagte die Friedericke und gab mir einen Stoß. Sollte ich sie mal im Himmel treffen, bekommt sie den Stoß wieder, die hat mich so oft geärgert, das alte Reff. Aber ich war noch nicht aus der ersten Aufregung raus, da kamen die zwei Sauschneider-Mädchen, die Rosa und die Margarethe, und gerade die zwei hatte der Nebegad so sehr oft gebissen. Aber die hatten keine Freude an seinem Tot. „Der arme Matz“, sagte die Rosa, und sie liefen und suchten Blumen und Gräser und banden dem armen Gänserich einen schönen Kranz und steckten ihm eine schöne weiße Schafgarbenblume in den Schnabel. Nun nahm ich den Korb wieder auf den Buckel. Und als ich ein böses Gedicht auf die Wiedehopp-Mädchen fertig hatte, war ich auf dem Nussberg und suchte am Haus des Advokaten Bock die Klingel. Aber sucht mal eine Klingel, wenn keine da ist. Auf jeden Nagelkopf hab ich gedrückt, aber klingeln tat es nicht. „Siehst du nicht, du Harzer Krummochse, dass der einen Kloppding (Türklopfer) an der Haustüre hat“, so fuhr mich ein Nusserberger Junge an, der wahrscheinlich vom Mistausbreiten kam, denn er hatte die Mistgabel auf der Schulter und seine Stiefel waren voller Dreck und Schneidespäne. Und mit seinen Lahtschern (Stiefel) trat er ein paar Mal derb an die Türe, drinnen wurde es lebendig. Bald knarrte die Haustüre und der Advokat kam. Es war ein großer, langer Kerl in Schlafrock, Zipfelmütze und Babuschen (Filz- Hausschuhe). „Es ist doch kolossal, was wir jetzt für eine Witterung haben“, sagte er, das war sein Leibspruch. „Was willst du?“
Ich haspelte schnell meinen Spruch herunter, hatte aber wahrscheinlich tüchtigen Quatsch gesagt, denn der Herr Advokat sagte: „Ist doch kolossal, was wir jetzt für eine Witterung haben. Anfang Oktober und noch Heupferde.“ Mit den Heupferden meinte er mich. „Nun, was bringst du? Ist doch kolossal...“ „Den Nebegnedzar bring ich.“
„Ist doch kolossal, was wir jetzt für Witterung haben. Bringt mir der Heiducke den alten Kümmeltürken Nebugadnezar. Ich erkläre dir aber kurz und bündig, dass ich jegliches Getier, so da kreucht und fleucht, verabscheue. Ich liebe nur zwei Vögel, die Gans und das Schwein; Kuhhasen (Kaninchen), Katzen und Hunde, gleich ob sie Nebugadnezar oder Abedenego heißen, hasse ich. Hast du es gehört?“
„Nein.“
„Ist doch kolossal, was wir jetzt für Witterung haben! Versteht der Mensch kein Deutsch? Ich sag dir nur: Mache dir keine Illusion und gewöhne dich an Logik. Verstehst du?“
„Nein, ich verstehe sie nicht.“
„Ist ja kolossal, was wir jetzt für eine Witterung haben. Bei euch ist wohl der Zapfen eingefroren?“
„Ich weiß nicht, und ich mag es auch gar nicht wissen. Ich bringe Ihnen keinen Löwen und auch keinen Hund. Ich bringe von der Bachbäuerin den Nebegadnezer. Der war früher ein Gänserich, aber jetzt ist er tot.“
„Ist doch kolossal! Ein Gans bringst du? Da kommst du doch wie gerufen. Natalgen, Nataligen, komm doch stande pede, der Junge hat eine Gans! Ach, da entsinne ich mich, Natale ist einkaufen gegangen. Packe die Gans aus!“ Ich tat es. Als der alte Mann das Blumenkränzchen sah, dass die beiden Mädchen dem Gänserich umgehängt hatten, sagte er: „Sehr poetisch, sehr niedlich. Ist doch kolossal, was wir jetzt für eine Witterung haben. Sehr nette, vortreffliche Frau, die Bäuerin!“ Und nun nahm er den Gänserich raus, wog ihn mit der rechten und wog ihn mit der linken Hand und sagte mit strahlendem Gesicht: „Ist doch kolossal, was wir jetzt für eine Witterung haben. Eine Gans ist mir lieber denn eine Nachtigall.
Denn ohne ihre weisheitsvollen Spulen
wo wäre Wissenschaft,
wo unsre Kanzleien, hohe Schulen,
wo die Beamtenschaft?“
Er trug die Gans raus, kam aber gleich wieder. „Kann dich leider nicht nach Gebühr entlohnen, denn der Brotschrank ist leer. Und sämtliche Sportel-, Accisse-, Haupt- und Gefällkassen hat Frau Advokat mit. Aber du sollst kolossal belohnt werden. In etwa vier Wochen nehme ich die Winterbirnen ab, da kommst du und holst dir einen halben Scheffel.“ Es passte mir zwar nicht, dass ich so nackit (ohne Belohnung) fort musste, und ich ärgerte mich tüchtig darüber, dass die Advokaten nichts im Haus haben, wenn ihnen ein Junge eine Gans bringt. Die kommenden vier Wochen passte ich genau auf, dass der liebe Gott ein richtiges zum Birnenreifen machte. Und ich muss sagen, ich war mit dem gesamten Wetter zufrieden. Es war ein wunderbarer Herbst und bis in den November hinein schien die liebe Sonne. Endlich aber besann sich der Herbst darauf, dass er die Pflanzen und Gräser zu Bett bringen musste, eh der Winter mit Eiszapfen wirft. Er machte ein verdrießliches Gesicht, hatte die Nebelkapuze aufgesetzt und schrie in der Nacht: „Schert euch zur Ruhe, der Winter kommt!“ Da trieb der Kuhjunge nicht mehr aus, da begann das Dreschen in der Scheune, da lief ich zum Nussberg wegen meiner Birnen.
Und diesmal hatte ich Glück. Ich fand den Klopfer an der Türe, die Frau Advokat, eine kleine freundliche Frau machte auf und führte mich in die Stube. Und die hoch erfreuliche Aussicht: der Herr Advokat lag in einem Faulenzerstuhl, las ein kleines Heftchen und aß Birnen dazu, die neben ihm auf dem Tisch standen. Feine, rotbackige Birnen waren das. Drei davon verschlang ich gleich mit den Augen. „Ist doch kolossal, was wir jetzt für eine Witterung haben. Künftig holen wir das Solaröl bei dem alten Grimm in Grünhain, wir holen´s in der Klostermühle, man hat nämlich in dem Klosterteich eine Solarölquelle entdeckt. Ist doch kolossal! Was will denn der Bursche?“ „Um meine Birnen bitte ich.“ „Der König tut Taten und der Wächter tut Tuten. Alles mit Unterschied. Ist doch kolossal, was wir jetzt für gottlose Jungen haben. Herznatalgen, das ist der Bube!“ Die Frau schaute mich scharf, aber nicht bösartig an. „Das ist der Bursche, der uns den Sorgenganserich, den Schmerzensganser, den Tränendomesticus ins Haus gebracht hat. Wer den Dichter nicht ehrt, ist des Liedes nicht wert. Sieh dir diese Frau an, sie ist in puncto Kochen ein Genie, ihre Braten sind Gedichte. Und dieser unselige Nebgadnezer geriet ihr nicht. Mit ihren Tränen hat sie in versalzen. Und ich saß hier an diesem Tisch, wetzte Messer und Gabel aneinander und formte vor Langweile Brotkügelchen. Da platzte sie herein mit der Kummerbotschaft, der Tantalusnachricht: Joachim, der Braten ist noch hart. Wie alt war dieses greuliche Gänsetier? Bei den Manen deiner Väter rede die Wahrheit!“
„Vierunddreißig Jahre, sagt man, wäre sie alt gewesen.“
„Deckt sich fast mit meinen peinlichen Recherchen. Nataligen, hörst du? Vierunddreißig Jahre war der Nebugadnezer alt. Ist doch kolossal, was wir jetzt für Witterung haben. Isst man solche Gänse? Verkauft man sie? Trägt man sie frommen Menschen ins Haus? Bursche, Bube! Verräter! Weißt du, wer Wallenstein war? Rede!“
„Ein Hauptmann im Dreißigjährigen Krieg.“
Ein Hauptmann – Blech – Generalissimus war er. Und wie sagen seine Soldaten: Er trgt einen Koller von Elenshaut, dass keine Kugel kann durchdringen. Man nennt diesen Elen auch Elch oder Schelch. Weißt du, was ich tun werde? Kugelfangende Koller brauche ich nicht, ich werde mir aus der Gänsehaut eures Nebugadnezers beim Hosenbeutler eine Lederhose machen lassen. Lebte Wallenstein noch, würde ich ihm diese Haut submissest dedictieren. Und wie heißt es weiter im Wallenstein, Bube?
´Auf das Unrecht folgt das Übel
wie die Träne auf die Zwiebel´.“
Und als er das gesagt hatte, stand er auf und schlug mir das Heft ein paar mal derb über die Ohren.
„Joachim, bezähme dich!“ warnte seine Frau. „Ach was, ich muss mich auswettern, ist doch kolossal, was wir jetzt für Witterung haben.“ Die freundliche Frau steckte mich zur Türe raus.
Das war meine erste Bekanntschaft mit dem „Glückauf“ (Zeitschrift des Erzgebirgsvereins) und meine letzte mit dem Advokat Bock. Er ist nach Dresden gezogen. Aber den halben Scheffel Birnen ist er mir heute noch schuldig.
* * *
Anton Günther
Der wohl bedeutendste Volksdichter und Liedermacher des Erzgebirges wurde am 5. Juni 1876 in Gottesgab (Boži Dar, Tschechien) als Sohn eines Bergmanns geboren. Er besuchte in St. Joachimsthal (heute Sv. Jachymow) die Grundschule. Danach lernte er in Buchholz (Schwesterstadt von Annaberg) in der Karlsbader Straße den Beruf eines Lithographen. In seiner Prager Zeit (1895-1901) entstanden viele seiner Lieder, die er bei seiner Rückkehr nach Gottesgab auf Postkarten drucken lies (Erfinder der Liedpostkarte) und verkaufte. Nebenbei betrieb er eine Kleinlandwirtschaft. Er trug viele seiner über 100 Lieder, zahlreichen Gedichte und Mundart-Erzählungen in Veranstaltungen selbst vor. Unter dem psychischen Druck der politischen Verhältnisse beging der „Sänger des Erzgebirges“ am 29. April 1937 Suizid. Am Ende des selben Jahr erschien eine Gesamtausgabe seines Werkes aus dem die folgenden Texte übertragen wurden:
Auf einem Hirsch geritten
(Of´n Hirsch gerieten)
Zu jener Zeit, als es in Gottesgab noch mehr Vieh gab, da hatte eine Hirte drei Schock Rindvieh zu hüten. Da hat der alte lange Wenz mit gehütet und der kam im Wald an eine Schachtel. Damals war der Wald viel dichter wie jetzt, da konnte man kaum durch gehen. Und als er dann in die Schachtel rein schaute er traute seinen Augen nicht, lag ein drinnen und hat geschlafen. Der lange Wenz, ganz erschrocken, wusste vor lauter Eile nicht, was er machen soll. Er sprang auf den Hirsch drauf und erwischte ihn am Geweih. Nun, der Hirsch steht auf und rennt mit dem Wenz durch dick und dünn fort. Ja, der hätte gerne den Hirsch los gelassen, konnte aber nicht. Immer weiter durch den Wald ging der Ritt, das Gesicht hatte er schon ganz zerkratzt, der Anzug hing in Fetzen runter. Und weiter ging es, bis er hinter dem Försterhaus zusammengebrochen ist und der Wenz halbtot unten lag. Als der Hirsch gespürt hat, dass es leichter wurde, holla, da war er weg und der Wenz lag da mit lauter Kratzer und keinen Fetzen mehr am Leib. Der hats sich seitdem auf keinen Hirsch mehr drauf gesetzt.
1904
O du verkehrte Welt
(O du verkehrte Walt)
Neulich meint ein Alter, der bei uns hutzen (zusammensitzen, treffen, reden) war, weil doch jetzt das Schneeschuhfahren und das Ruscheln (Rodeln) so aufgekommen ist: „Die Welt wird jatzt ganz verdreht. Früher, wenn wir einmal geruschelt sind, da kam gleich der Kantor oder der Polizist, und da musste man sich schnell aus dem Staub machen, sonst war der Schlitten weg. Und jetzt fährt der Lehrer selber mit. Was sagt ihr den dazu? O du verkehrte Welt!“
1904
Wegen eines Kusses
(Waagn enn Schmatz)
Die Albert Jule und die Fickel Mine waren Freundinnen, und die haben sich auch alles erzählt. Einmal war doch der Heim bei der Jule zu Besuch. Am anderen Tag sagte die Jule zu der Mine: „Heute Nacht konnte ich kein Auge zumachen, der Heim hat mir gestern einen Kuss gegeben, und nun hab ich Angst, dass ich ein Kind bekomme.“
1904
Bei der Firmung
(Be dr Firming)
Es war Firmung. Der Erzbischof war da, hat die Kinder geprüft und hat unter anderem gefragt: „Kinder, was stellt Ihr Euch denn unter dem Herrn der Heerscharen vor?“ - Keiner hat sich gerührt. Endlich, der kleine Edelward reckt die Hand in die Höhe. „Also doch einer, Du weißt es also. Also, was stellst Du Dir vor mein Kleiner: Der Herr er Heerscharen?“ DerEdelward meinte: „Das wird halt ein Korporal gewesen sein.“ „Also, er hat doch einen Begriff davon“ - freute sich der Bischof. In der zweiten Frage ging es um Josef von Ägypten. Da kam man auf einen Mundschenk zu sprechen. Der Bischof fragt: „Was versteht Ihr denn unter einem Mundschenk?“ Wieder hat sich niemand gemeldet, außer den Edelward: „Wird halt ein Wirt gewesen sein.“
1904
Der Schatten
(Dr Schattn)
Der alte Oberlehrer Kriegelstein hat nur einen kleinen Schnurrbart und unter dem Kinn eine Fliege. Einmal kam er am Abend zu spät in den Gasthof zu den Stammgästen. Als sie ihn fragten, wo er jetzt erst her komme, sagte er: „Also, Leute, was mir heute passiert ist. Es ist irgendwas nicht richtig am Steinbruch. Ich gehe von Wiesenthal raus. Und als ich bald am Steinbruch war, da ist mitten auf der Straße ein Graben. Ich mach einen Sprung, und wieder einer. Nun bin ich ordentlich erbost. Ich gehe wieder ein Stück, da ist wieder ein Graben. Nun bleibe ich stehen und schau mich überall um, - endlich hatte ich es erkannt: Da schien der Mond und mein Schnurrbart hat seinen Schatten geschmissen, dass ich dachte, es wäre ein Graben.“
1905
Beim Vogelstellen
(Ben Vugelstelln)
Der alte Harzer Zwack fährt eigentlich Mist, aber im Frühjahr war der noch ein wenig gefroren. Nebenher war er noch Vogelsteller. Und wir waren auch so ein paar Jungs, die nicht weit weg davon auch welche gestellt haben. Aber wir haben nichts gefangen. Wenn ein Vöglein kam, sind die alle zusammen rüber zu ihm geflogen, weil der Zwack einen guten Lockvogel hatte. Da haben wir uns immer geärgert. Wir haben wirklich lange gewartet, dann kam der Nebel gezogen und da war keinen dort, weil sie beim Mist waren. Ich schleiche mich hin, hab unseren Quaaker (Lockvogel) in denen ihren Bauer gesteckt und denen ihren Vogel raus genommen und in unseren Bauer rein gesteckt. Nun sind wir freilich am anderen Tag auch nicht Vogelstellen gegangen. Da meine der Zwack: „Sagt mir nur mal, mein Quaaker muss ganz heißer sein, der tut heute überhaupt nicht seine Gusch (Mund, Schnabel) auf, es ist wahrscheinlich gestern ein wenig zu kalt gewesen.“
Diese Geschichte hat der Kühn Franz erlebt.
1905
Der einzige Bettelmann
(Der aanzige Battelma)
In Wickwitz gab es nur einen einzigen Bettelmann. Wenn der betteln gegangen ist, wie es früher so war, wo der Kreuzer noch einen Wert hatte, hat er einen Heller, dort ein Stückchen Brot oder ein „Helfe Dir Gott“ bekommen. Einmal triffte re den Vorsteher, sie waren per Du miteinander, wie es eben in solch kleinem Ort üblich ist. Sagt der Bettelmann: „Horch mal, wann habt ihr denn wieder mal eine Sitzung? Ich hätte etwas Wichtiges vorzubringen.“ „Nun, das kannst du mir doch gleich sagen“, meinte der Vorsteher. „Nein, das muss ich selbst vorbringen.“ „Nun, kommste halt morgen, da ist wieder Sitzung.“ Richtig, die Sitzung findet statt, der Vorsteher sitzt mit den Ausschüssen zusammen und da kam auch der Bettelmann herein. „Also, was ist denn so wichtig, was du so bringst?“ Da sagte der Bettelmann: „Horchen sie meine Herren: Ich bin der einzige Bettelmann. Was ich da bekomme ist einmal ein Heller, mal ein Stückchen Brot und auch mal gar nichts, davon kann ich nicht leben. Wenn ihr da keine andere Regelung trefft müsst ihr euch bald einen anderen Bettelmann anschaffen, ich mach keinen mehr!“ - und zur Tür raus war er.
1907
Vom Schmuggeln
(Ven Paschen)
Der kleine Eduard hatte sich einmal in Wiesenthal einen neuen Hut gekauft, da waren oben solche Reifchen dran. Das war damals was Neues. Er hat den Hut im Neuen Haus gelassen. Einmal hat er einen ganz alte Mütze aufgesetzt, ist rauf gegangen und wollte den Hut holen Im Neuen Haus hat er dann einen halben Liter um den anderen getrunken und war schon ein wenig angeraucht (beschwipst). Der Hut war in einer Tüte drinnen, und anstatt den Hut aufzusetzen, hat er in seinem Suff die alte Mütze aufgelassen und den Hut in der Tüte getragen. An der Grenze hat er überlegt, ob er den Steig oder die Straße gehen soll – er nahm den Steig. Als er zum Wachhäuschen kam, wer stand da? Der alte Lorenz, was damals der Oberaufseher war, und besoffen. „Was tragen Sie da in der Tüte?“ Der Eduard sagte: „Ich weiß nicht.“ „Also gehen Sie mit aufs Zollamt.“ nun sind wir eben gegangen, erzählte der Eduard, mehr getorkelt als gegangen. Jetzt war ich aber so gescheit, schließlich war der Lorenz besoffen, und habe mir hinter ihm geschwind meinen Hut aufgesetzt und die alte Mütze in die Tüte gesteckt. Auf dem Zollamt war keine Zollstunde mehr. Da sagte der Lorenz: „Also müssen Sie die Tüte da lassen und kommen morgen wieder.“ Ich habe die Tüte mit der alten Mütze legen gelassen und bin mit meinem neuen Hut nach Hause. - Die konnten warten, bis ich kam.
1908
Die Sakramente
(De Sakrementer)
Der Zachenwenz (Wenzel Zachen) geht zum alten Dechant in das Tal zum Examen für die Hochzeit. Da fragt ihn der alte Dechant, wie viel Sakramente es denn gibt? „Fünfundzwanzig“ sagt der Wenz. Da schickte der alte Dechant ihn wieder nach Hause, er solle erst mal lernen. Unterwegs trifft er einen Bergmann, seinen Kameraden, der will auch heiraten und geht zum Examen. Der Wenz fragt ihn: „Weißt du denn auch, wie viel Sakramente es gibt?“ Sagte der darauf: „Halt sieben.“ „Ja“, sagte der Wenz, „geh nur zum alten Dechant mit deinen paar Stück, ich habe fünfundzwanzig gesagt und das war noch nicht genug.“
1909
Der Kalender
(Der Kalender)
Der Ehrenbau Pepp (Josef) trägt jedes Jahr die Kalender aus. Kam er auch mit einem neuen Kalender zu den Försterhäuser, wo eine alte Frau wohnte. Sie sagte:“ Brauch in diesem Jahr aber keinen, der alte ist noch tadellos wie neu.“
Der Ehrnbau Pepp trögt alle Gahr de Kolander rüm. Kam er aah mit en neie Kolander nooch Färschterhaiser ze ner alten Fraa. Sat die: „Brauchn heier fei kan, es is der alte noch wie nei, is noch kaa Utaatel dra.“
1912
Von der Johanna Wagner
(Ve de Wogner Nann)
Als die große Hungsersnot war, hatte man die Johanna Wagner aus dem Armenhaus gefragt: „Nannel, wie geht’s denn?“ „Halt der schreckliche/verdammte Hunger“, sagte sie, „ich würde ein Pferd gleich mit dem Hufeisen fressen.“
Wie darr gruße Honger e su war, hobn se de Wogner Nann aus ´n Armehaus e Mol gefrogt: „Nannel, wie gieht´s denn?“ „Halt daar donnerkeilische Honger,“ sat se, „ich frassit doch e Pfarr mit z´ammsten Eisen.“
1920
Judensklaven
(Judensklaven)
Gestern und heute liegt der Nebel büscheldick. Die Mark ist nur noch acht Heller wert. Gestern meinte die Frau vom Schlebäck-Seff (Bäcker Josef Schle): „Die Mark gilt gar nichts mehr.“ Da ist alles nach Wiesenthal gerannt, in der Zwischenzeit ist die Mark wieder gestiegen. Heute früh bin ich bei dem Nebel Semmeln beim Taiber Bäck (Bäcker Teuber) holen gegangen und hab dort den alten Salzer getroffen. Sagte ich: „Das ist aber heute ein unerfreuliches Wetter.“ Sagte er: „Mißgetimmtes Wetter.“ Danach bin ich ein Stück mit ihm gegangen. Dann sind wir mal stehen geblieben und er fragte mich: „Hast wohl wieder einen recht großen Schein gewechselt?“ „Ja“, sagte ich, „das ist nichts mehr, die Kronen sind rar. Tausend Mark, die hat man jetzt schnell.“ „Und weißt du denn auch, wer uns in diese Klemme gebracht hat?“ fragte er. „Und weißt du was wir sind? Wir sind keine Tschchensklaven, auch keine Franzosensklaven! Wir sind Judensklaven, die haben uns in den Krallen! Das, was vorne rein kommt, ist schon hundert Mal versteuert, und das, was hinten raus geht, sogar der Scheißdreck, mit Respekt zu melden, sogar der muss versteuert werden. Wenn ich heute noch mal zwanzig, dreißig Jahre wäre und das Bier halbwegs billig, da ging es uns besser. Leb´ wohl Anton!“
1922
Da drücke ich immer die Augen zu.
(Do drück ich immer de Aagn zu)
Der alte Seff (Josef) hat Bier gefahren und hat immer, weil er gerne einen getrunken hat und ein wenig besoffen war, auf dem Bock (Schußkahl = die „Kaule“ auf dem Pferdebock vor der Sitzbank) geschlafen. Einmal kam der Polizist/Gendarm (Schandarm) und hat ihn angehalten. „Warum schlafen Sie immer, Sie wissen doch, dass das strafbar ist?“ „Da kann ich nichts dafür“, sagte der Seff darauf, „ich mag den Polizisten nicht gern sehen, und da drücke ich immer die Augen zu.“
1923
Die geht auch rüber
(Die gieht rüber aah)
Beim Süß in der Stube, was früher das Bundesheim war, das nennen sie zur „Hutschachtel“, weil da früher so ein kleines Wirtshaus war, dort saßen immer gegen Abend ein paar gemütliche Leute beisammen. Zu jener Zeit war es überhaupt gemütlicher. Wie es eben vor dem Krieg war, als sich die Leute noch besser vertragen haben. Man hat keinen Unterschied gemacht wie heutzutage, da saßen eben alle zusammen, ob das Lehrer oder Waldarbeiter, Bordenhändler, Musikanten, Bäcker, Fleischer oder Fuhrmänner waren, Finanzbeamte oder Schmuggler, das blieb sich gleich, die haben sich eben vertragen und einander geachtet. Und deshalb war es auch gemütlicher als heutzutage. Über Politik haben höchstens ein paar Bessere, wie man so sagt, hier und da mal geredet, ansonsten hat man sich nicht viel darum gekümmert.
Wenn nun die langen finsteren Abende im Herbst ran kamen, das wenige Heu auf dem Boden war, das Heizmaterial drinnen, die Türen gefüttert, die Doppelfenster angebaut, auch schon ein wenig Krippelmost (Krabbel-Most, Sturm, Federweißer) zu Hause war, und man hatte ein paar Sechser übrig, ist man abends gern auf einen halben Liter Bier gegangen, der hat sieben Kreuzer gekostet. Wenn man in das Stübel rein kam, saßen da immer paar gemütliche Leute. Der Emil, das heißt, seine Frau, hat immer solche großen Heringe eingelegt. Da hat man sich einen Scheibe Brot genommen, solche einen Hering gegessen, einen halben Liter Bier dazu getrunken und danach noch eine Pfeife Tabak geraucht.
Ich bin auch wieder mal gegen Abend rüber gegangen, draußen hat es schon geschneit. Da hat man sich beeilt, um in die Stube rein zu kommen. Durch den Tabakrauch konnte man die Leute zuerst gar nicht erkennen, erst als man sich etwas daran gewöhnt hat. „Guten Abend!“ „Willkommen, nimm nur Platz!“ Und schon saß man hinten auf der Bank oder auf dem alten Kanepee (Sofa). Im alten Kachelofen ist das Feuer nie ausgegangen, dafür hat Emils Frau schon gesorgt. Die hat den ganzen Sommer solche starke Äste nach Hause geschleppt und die sind wie der helle Satan, wenn die zu brennen anfangen. Da saßen nun einstmals, sie sind schon alle gestorben, Gott gebe ihnen den Himmel, der Prager Karl, der der Wassermacher war, er hat den 70er Krieg mitgemacht. Der alte Frühauf Tonel hatte sich mit der Schmuggelei gut ausgekannt. Der Glöckner, der alte Unger Herrmann, der hat immer paar Schnorken erzählt. Auch mein Schwiegervater, der alte Zettel, war dort. Neben mir saß der Albrecht Habnnes, der Förster, und neben dem der Sommerkattel Hans, der war zu jener Zeit Armenhausvater. Da wurde nun allerhand diskutiert. Unter anderem am auch die Diskussion, weil sie ja alle viel gereiste Leute waren, auf das Reisen, denn die alten mussten oft hinaus in die Fremde und haben sich mit der Musik oder mit dem Bordenhandel das Brot verdient. Da war auch die Rede von Pürschstein an der Eger. Der Albrecht Hannes, ein hühnischer Wolf, hat eine solch große Holzpfeife geraucht, dass es aussah, als wenn Brot gebacken wird. Der Sommerkattel Hans einte: „Ja vor dreißig, fünfunddreißig Jahren kam ich auch dort hin, da geht doch einen Brücke über die Eger.“ Der Hannes qualmte und horchte und der alte Hans erzählte von seinen Reisen und immer wieder mal: „Ich weiß ganz genau, das dort einen Brücke rüber geht.“ Der Hannes qualmte und sagte nichts dazu. Das Erzählen geht weiter und immer sagte er wieder, wenn er einen Schluck aus seinem Glas getrunken hatte: „Ja, da geht eine Brücke über die Eger. Da sind wir mal hinüber gegangen und mussten einen Kreuzer zahlen.“ Vielleicht eine Viertelstunde lang hatte er schon erzählt, der Hannes bläst den Rauch dem alten Hans seitlich ins Gesicht und der Hans sagt noch einmal. „Nun, dort geht eine Brücke hinüber.“ Endlich macht der Hannes noch einen tüchtigen Zug aus seiner Pfeife und sagt ganz gemütlich: „Die gieht rüber aah“ (Die geht auch rüber).
Das hab ich mir gemerkt, und als nach dem Krieg der, , die Arbeit nimmer geachtet haben Umsturz kam und alles so verwirrt getan hat, wie die Leute auf einmal eine neue Welt aufbauen wollten, wie sie alles, was immer recht und gut war, nimmer geachtet haben, wie sie auf einmal lauter neue Parteien gründeten, von Gott und Kirche nichts wissen wollten, wie sie nicht mehr wussten, wie sie sich modisch kleiden sollten, da habe ich an einem Abend im Wirtsstübchen daran gedacht und hab mir gesagt: Nein, ich mache nicht mit. Ich bleibe hier drüben über der Brücke, denn die, die auf die andere Seite gegangen sind, die kommen auch wieder herüber, wenn es nicht schon zu spät ist. Und die Zeit wird kommen, wo mein Volk wieder zur Einsicht kommen wird. Die von ihrem Volk weggegangen sind und dachten, jetzt sind wir international, die werden noch mal gern zu ihrem Volk zurückkehren. Die nichts mehr von Gott und Glauben wissen wollen, die werden noch mal zu Kreuz kriechen. Und die ihre Heimat, den alten guten deutschen Brauch nimmer geachtet haben, die werden froh sein, wenn sie ihre alte Heimat noch haben und werden dahinter kommen, dass es in der Heimat noch am besten ist.
Ja, ja, einen Brücke geht hinüber, oder sie geht auch rüber. Deshalb ist es am besten, man bleibt gleich hier. Hier hüben bleiben, heißt treu bleiben, treu er Heimat und treu dem Volk!
1923
Wegen des Wetters
(Waagne Watter)
Weil es andauernd geregnet hat sagte eine alte Frau zum Schlebeck Tonel (Anton): „Was soll den bei uns noch mit dem Wetter werden?“ Da sagte der Schlebeck Tonel drauf: „Da kann ich nichts daran machen, ich habe mit dem Regen nichts zu tun, weil ich in diesem Jahr für die Gewitter verantwortlich bin.“
1923
Aus der Hungerzeit
(Aus der Hongerzeit)
Als zur Kriegszeit der große Hunger herrschte, kam der Orr-Hannes, der in Niederösterreich im Hinterland in der Offiziersküche war und noch nichts vom Hunger gespürt hatte, einmal auf Urlaub nach Hause. Und wie es damals war mit der Esserei – eine Spottschande. Da kam der Kutsch-Jus, die lange dürre Latte mit einer leeren Schubkarre gefahren. Also schon die Länge und dürr und jetzt auch noch Hunger...
Beim Torfstechen hat er immer Leinkuchengetzen mit gehabt. Da könnt ihr euch vorstellen, wie prasseldünn der war. Er ist nur so herum geschwankt.
Vor dem Orr-Wirtshaus steht der Hannes. Sie waren schon immer Kameraden. Da lässt der Jus vor Schwäche den Schubkarren fallen und geht auf den Hannes zu. „Wie geht’s dir denn, junger Mann?“ sagte der Jus. Es ist ihm wahrscheinlich die Hose etwas gerutscht, da hat er sie mit dem Gürtel festgezogen. Der Hannes meinet: „Um Gottes Willen hör auf, sonst bricht dein oberer Teil noch weg!“ Das war damals ihr Gruß, und da haben sie in diesem Elend gelacht, dass ihnen die Tränen gekommen sind.
1924
Viele Peter
(Lauter Peter)
In Baßberg (Sebastiansberg) hatten sie einen neuen Straßenkehrer bekommen. Wie bei uns in Guttsgob (Gottesgab) der Name Günther zu Hause ist, so ist es dort mit dem Namen Peter. Es gab viel Schnee und da wurden viel Schneeschieber gebraucht. Die mussten sich alle bei dem Straßenkehrer melden. Der musste nun immer wieder in sein Büchlein reinschreiben „Peter“ und wieder „Peter“. Nun sagte der Straßenfeger: „Da muss doch der Petrus seinen ganzen Sack verloren haben.“
1924
Guten Abend!
(Guten Obnd!)
Zu viel und zu wenig, ist ein und die selbe Sache! So ist es auch mit dem Grüßen, das hat einmal der Ehrbau Pepp (Josef) erlebt. Einmal hat der Oppel an einem Tag Kuhdung gefahren, als der Nebel besonders stark war. Am Abend, gerade bei der letzten Fahrt, als er nach Hause wollte und in die Fischergasse rein fuhr, bricht ihm am Wagen ein Rad. Nun muss er den Wagen zusammen mit dem Kuhdungfaß stehen lassen. Als es nun finster wurde, hatte der Ehrenbau Pepp noch einen Weg und ging die Fischergasse runter. Er grüßte sonst alle Leute, denn er ist ein freundlicher Mann. Wie er nun die Straße hinunter geht grüßt er auch „Guten Abend!“ Keine Antwort. Der Pepp sieht nicht gut und geht ein wenig dichter ran: „Nu, guten Abend, sage ich!“ Immer noch keine Antwort. Er geht noch ein wenig weiter: „Nun, könnt ihr den keine Antwort geben, wenn man grüßt? Guten Abend sage ich!“ „Nun, wer seit ihr denn?“ Er blinzelt noch ein wenig, fasst an und – es stinkt. „Auch noch ein Kuhdungfaß!“ Aber da hat er den Kopf eingezogen und ist gegangen. Und als er erzählte, musste er selbst darüber lachen.
1925
In Cranzahl
Als ich in Cranzahl durch die Sperre gegangen bin und hab meine Fahrkarte entwerten lassen, hörte ich von weitem den Zug heran rumpeln. Ich fragte den Schaffner, der die Karte zwickte: „Geht wohl gleich los?“ Weil ich mit dem kleinen Wiesthaler Zug nach Hause fahren wollte. „Aber nein,“ sagte er, „es ist doch der große Zug noch nicht rein.“
1926
Kopfarbeit
(Kopparbit)
Es war ein Bauer, der brauchte einen Taufschein und einen Trauschein, und er fragte den Pfarrer, was er ihm dafür schuldig sei. „Vier Mark und 50 Pfennige,“ sagte der Pfarrer. Da meinte der Bauer, ob er nicht etwas dafür machen könnte. Der Pfarrer meinte, er wüsste nicht, aber vielleicht könnte er höchstens den anderthalb Meter aus dem Wald rein schaffen. Es wäre auch nicht weit weg und es liegt gleich am Waldsaum, schon raus gezogen. Nun hat also das Bäuerlein gefahren. „Was bekommen Sie denn?“, fragte der Pfarrer. „Nun, das rechnen wir halt auf“, meinte der Bauer. „Ja, dass kann doch unmöglich soviel kosten. Sie haben doch das Holz bloß vom Walde herein gefahren, das ist doch nicht so weit.“ Nun sagte der Bauer: „Herr Pfarrer, Sie haben doch weiter nichts gebraucht als zwei Bogen Papier, ein wenig Tinte und eine Feder. Beim Holzfahren war aber ich dabei, meine Ochsen und der Wagen dazu. Und das Auf- und Abladen.“ „Ja meine Arbeit ist auch Kopfarbeit und das muss bezahlt werden“, sagte der Pfarrer. „Also, nun meine Ochsen musste auch den Wagen mit dem Stirnblock hinterher ziehen, das ist wohl keine Kopfarbeit?“
1926
Wegen dieses unmöglichen Menschen
(Waagn dan Dingerich)
In Böhmisch-Scheid lebte ein altes Paar, das sich nicht vertrug. Wie es eben manches Mal so ist. Er war ein Saufaus, hat die paar Kreuzer versoffen, und wenn er die Treppe herauf getorkelt kam, begann jedes Mal der Streit, und er hat auch seine Franzel (Franziska) verprügelt. Sie musste sich zu tote klöppeln und er hat das Geld versoffen. Einmal kam er wieder besoffen nach Hause und wollte sie verprügeln. Sagte sie was, war es nicht recht, und hat sie nichts gesagt, ging es halt auch los. Jetzt hatte sie es aber satt, packte ihren Klöppelsack zusammen, das Kopftuch umgehängt, ist zur Türe raus und sagte: „Jetzt wird ins Wasser gesprungen.“ Es war toter Herbst und draußen schon gefroren. Eine Kälte, dass die Nadeln auf das Dach knallten. Als sie zum Teich kam und das Eis sah, hat sie die Kälte gebeutelt. Sie zieht einen Socken aus und hält mal einen Fuß rein. Jesus, die Kälte!
Sie hat ihren Socken wieder angezogen, den Klöppelsack unter den Arm genommen und ist zur Nachbarin hinüber gegangen. Dort brannte noch Licht. „Wo kommst denn Du noch her, Franzel?“, sagte sie. „Ach Du weißt doch, mit meinen besoffenen Schweinebengel kann ich doch nicht mehr leben. Ich wollte ins Wasser springen – aber auch wieder nicht! Ich werde mir doch wegen dieses Mistvieh nicht auch noch eine Erkältung holen!“
1926
Von der Mode
(Ve der Mode)
Der alte Richter Bäck (Bäcker Richter) sagte dieses Jahr einmal, weil doch die Mode eben jetzt so ist unter den Mädchen und alle viele farbige Kleider anhaben: „Wenn jetzt die Kirche aus ist, und man sieht die so die Mädchen, dann sieht das so aus, wie damals bei den alten Frankele-Mädchen auf deren Tablett, wo die geblümten Töpfchen und Tellerchen drauf standen.“
1928
Magenkatarrh
(Mognkatarrh)
In Zwittermühle war eine Frau magenkrank. Da haben sie den Doktor aus Platten geholt und der hat die Frau untersucht. Er sagte: „Die hat Magenkatarrh,“ und hat ihr etwas verschrieben. Nun kamen auch die Nachbarn und fragten, was ihr fehle. „Magenkatarrh hat sie.“ Der kleine Wenzel ging in die Schule. Unterwegs trifft ihn sein Paten-Vetter. Der fragt den Wenzel: Was fehlt denn deiner Mutter?“ „Ich weiß nicht“ meinte der Wenzel, „die hat eine Gitarr(e) im Magen.“
1929
Die Beine
(De Baa)
Wenn man einmal einen alten Menschen fragt, wie es ihm geht, bekommt man allgemein die Antwort darauf: „Ach, so oben herum fehlt mir nichts, da denke ich, ich könnte noch die Welt umreißen, aber halt die Beine, die wollen nicht mehr so recht gehen.“ Gestern Nachmittag bin ich wieder einmal nach Wiesenthal (Oberwiesenthal) gegangen, sonst bin ich immer er Straße nach, aber jetzt muss man wegen der Autos einen anderen Weg gehen. Wie an der Post vorbei kam, dort bei der alten Schule, sah ich den alten Müller-Bäck (Bäcker Müller). Darüber freue ich mich immer, denn es ist doch ein Stück aus meiner Jugend. Als die Bahn noch nicht bis Wiesenthal fuhr, da hat der alte Müller-Bäck den Buden-Fuhrmann gemacht und ist in der Woche drei- viermal nach Annaberg gefahren. Da hat er mir, als ich beim Schmidt in Buchholz in die Lehre ging, immer die Wäsche von zu Hause mitgebracht. Als ich ausgelernt hatte, es war im Winter, da hat er mein Zeug, das Federbett, einen Koffer und mich auf einem großen Kastenschlitten nach Hause gefahren. Es war eine kalte Nacht. Wir kamen gegen Mitternacht in Wiesenthal an. Nun musste ich dort beim alten Müller-Bäck auf dem Kanepee (Sofa) übernachten. Früh hab ich dann Kuchen und solche Dreierbrötchen bekommen und bin nach Hause. Da denke ich jedes mal dran, wenn ich den Alten sehe oder er an seinem Haus vorbei geht. Und heute haben wir auch wieder davon geredet. Und nun frag ich auch: „Geht´s denn noch, Alter?“ „Ach ja“, sagt er, „nur die Beine wollen halt nicht so. Früh, wenn ich aufstehen will, da muss ich mich erst eine Weile auf den Bettkasten setzen, bis die Beine ein wenig beweglich werden.“ „Nun, ja“, sage ich, „das ist so wie bei meinem Vetter. Der hat in den letzten Jahren auch das Reißen. Da saß er einmal vor dem Haus und ich hatte auch gefragt: Wie geht’s denn Vetter? Ach, geh mir nur weg, man macht halt im Leben lauter Dummheiten. Ich habe das ganze Leben gebetet, der liebe Gott soll mich nur gesund erhalten an Leib und Seele und die Beine hatte ich vergessen, nun sitze ich da und kann nicht mehr laufen. Hätte ich in mein Gebet auch die Beine mit eingeschlossen, käme ich heute noch vorwärts.“ Da haben wir halt gelacht und sind mit einem herzhaften Gruß auseinander gegangen. Aber gut wäre es schon, wenn man in sein Gebet nicht vergisst, dass einen der liebe Gott die Beine gelenkig erhalten soll.
1929
Eine gute Antwort
(E gute Antwort)
Weil ich gerade daran denke, lasst euch mal eine Geschichte erzählen: Der Prager Karl saß mit dem Julius, dem Nachtwächter und noch ein paar anderen in der Stube bei einer Maß. Kommt der Toler (Wiesenthaler) Schornsteinfeger herein, und der Karl, wie er nun mal so ist, will doch immer den Gescheiten spielen und fragte den Schornsteinfeger: „He, sag mir nur mal, für wen trauerst du denn das ganze Jahr?“ Sagt der drauf: „Für eure Dummheit!“ und ist raus zur Türe.
1930
Eine Nebelgeschichte
(Ene Naabelgeschicht)
Wir saßen mal abends beim Orr Hannes beisammen, da kamen noch drei Wanderer herein. Lustige Leute. Der eine hatte schon einen kleinen sitzen. Wie sie so diskutierten, hat man mitbekommen, dass es Vogtländer sind, sie waren aus Markneukirchen. Der Hannes bringt jedem ein Glas Bier und dann ging das Erzählen los – ´rüber und ´nüber. Da meinte der Gust (Gustav): „Als wir unten von der Dreckschenke hoch kamen, da hat ein solcher dicker Nebel gelegen, da habe ich meinen Stecken rein gesteckt und der Stecken war weg.“ Da sagte der Tonel (Anton), der mit bei uns saß: „Aber mir ist erst einmal ein Ding passiert. Ich war im Sommer mal in den Schwammen (Pilzen), ich hatte das Säckchen schon bald voll, da ist aber ein so dicker Nebel aufgekommen, dass ich sehen musste, aus dem Wald raus zu kommen. Weil ich Hunger hatte, habe ich mich am Waldrand hingesetzt, habe meinen Stecken an den Nebel ran gelehnt und und habe mein Brot gegessen. Meine Schwamme habe ich so freudig betrachtet. Der Magen hat sich schon auf die Schwamme-Suppe gefreut, und auf den Nebel habe ich gar nicht mehr geachtet. Ich packe meine Schwamme wieder zusammen. Oh, du schweres Unglück! War doch der Nebel weggegangen und hat meinen Stecken mit in die Höhe gezogen und der Stecken war weg.“ Da sagte der Gust: „Na, da müssen wir aber jetzt aufpassen. Wir wollen noch zum Kreisheim in Wiesenthal gehen, dass wir uns nicht an den Nebel anlehnen, der zieht und dann eventuell noch auf den Keilberg hoch.“
1930
Anton Günther
(Tolerhanstonl)
Als das alte Grüne Haus noch stand, der alte Grüne-Haus-Hermann noch Wirt war, war noch die alte gemütliche Zeit. Da saßen einmal zufällig als einzige Gäste wir fünf Anton Günther am Stammtisch zusammen. Wir haben uns da gut unterhalten. Da kamen zwei Fremde ´rein, es waren Sachsen, sie setzten sich an einen anderen Tisch. Der alte Bachmann-Tonel, als ältester Stammgast, sagte zu den Fremden, sie sollten sich nur mit zu uns ran setzen. „Na, wenn die Herren erlauben,“ kamen also ran an unseren Tisch und stellten sich vor, wir auch. Jeder sagte seinen Namen: Anton Günther, Anton Günther, Anton Günther, Anton Günther, Anton Günther. „Nu,“ sagte so ein Sachse, „meine Herren, Sie wollen uns wohl bloß veralbern?“ Da sagte der alte Bachmann-Tonel: „ Nein, wenn Sie es nicht glauben, da werde ich die Herren einmal vorstellen: Ich bin der Bachmann-Tonel, das ist der Wald-Günther-Tonel, der Hack-Tonel, der Toler-Hans-Tonel und das ist der Lügen-Tonel.“ Jetzt waren sie zufrieden und es ist ein großer Spaß daraus geworden, dass man fast das nach Hause gehen vergessen hatte.
Die zwei ältesten, der Bachmann-Tonel und der Wald-Günther-Tonel, liegen schon lange unter der Erde, der Toler-Hans-Tonel ist bekannt durch seine Lieder, der Hack-Tonel lebt in der Fremde und der Lügen-Tonel sagt noch heute Lügen. So ist es eben: wenn man unter den vielen Günther einen raus finden will, muss man den Spitznamen kennen.
1930
Drei letzte Sprüche von Anton Günther aus dem Jahre 1936:
Treudeutscher Gruß mit Herz und Hand
vom Erzgebirge zum Egerland!
Für uns gilt nur ein Feldgeschrei:
Wir bleiben unserem Volk, der Heimat treu!
Treideitschen Gruß mit Herz on Hand
ven Arzgebirg zen Egerland!
Für ons gilt när aa Feldgeschrei:
Mir bleibn onnern Volk, der Haamit trei!
* * *
Seit die Welt besteht, gibt’s Leid und Freuden,
wie die Menschen sind, so sind die Zeiten,
sind die Menschen gut, gibt’s Fried und Freud,
sind die Menschen bös, gibt’s Zank und Streit.
Seit de Walt bestieht, gibt’s Laad on Freiden,
wie de Menschen sei, su sei de Zeiten,
sei de Menschen gut, gibt’s Fried on Freid,
sei de Menschen bies, gibt’s Zank on Streit.
* * *
Gottesgab so heißt meine Heimat,
es ist mir das liebste Fleckchen auf der Erde.
Gaben Gotte sind meine Lieder,
darum halte ich es so lieb und wert.
Gottesgab su haaßt mei Haamit,
´s is mir´s liebste Flackel Erd.
Gaben Gottes sei meine Lieder,
drüm halt ich se su lieb un wert.
* * *
Heinrich Jacobi
Georg Heinrich Jacobi ist auch bekannt geworden unter dem Pseudonym Heinrich Montanus. Er wurde am 20. 12. 1845 in Schneeberg geboren und starb dort am 20. 05. 1916. Er ist der Sohn eines Schneeberger Bergfaktors. Er besuchte die Bürgerschule und das Progymnasium in Schneeberg, danach die Realschule in Annaberg und später die Universität in Leipzig. Nach erfolgreich bestandener Prüfung für das höhere Lehramt wurde er Lehrer an der Selekte in Penig. 1872 erhielt er eine Oberlehrerstelle in seiner Heimatstadt. Hier war er u.a. 1874 Gründungsmitglied des Naturwissenschaftlichen, später Wissenschaftlichen Vereins. Im Jahre 1881 wurde Jacobi Realschuloberlehrer in Werdau. Hier erlangte er mit einer Dissertation über Georgius Agricola die Würde eines Dr. phil.. Am 1. Januar 1893 wurde er Realschuldirektor in Reichenbach im Vogtland. Bleibende Verdienste erwarb er sich durch die Gründung einer Fortbildungsschule für Kaufleute in Schneeberg, die später zur Handelsschule erweitert wurde. Aus seiner Feder stammen zahlreiche Gedichte und einige Erzählungen in erzgebirgischer Mundart und in Hochdeutsch, aber auch volkskundliche und wissenschaftliche Texte sowie ein Schauspiel zählen zu seinem stark heimatverbundenem Gesamtwerk. Die im Jahre 1907 von ihm in Mundart geschriebene und nachfolgend ins Hochdeutsche übertragene Erzählung „De Zaahntenkasse“ (Die Zehntnerkasse), beruht auf historischen Tatsachen: Die darin vorkommenden Soldaten sind Parteigänger des Herzogs von Braunschweig, der im Verbund mit den Österreichern Anfang des Jahres 1809 mehrfach durch Sachsen zog und in Gefechten mit den Franzosen verwickelt war.
Die Zehnterkasse
(De Zahntenkasse)
Wenn man es so hört, was in den langen Kriegszeiten früher das Gebirge alles hat aushalten müssen, da kann man sich manches mal nicht genug wundern, wie das überhaupt überstanden wurde. Brot und Getreide, Geld und Kleidung, und alles was sie hatten, alles mussten die armen Leute her geben – nun, mein Gott, man weiß nicht, was größer war, die Wut auf das Kriegsvolk oder die Geduld der armen Leute. Ich hatte noch einen alte Kinderfrau, deren Mann war mit in Russland, und ihr Schwiegervater hatte auch die Kriegszeit unter Napulichu (Napoleon) mit erlebt, die konnten aber erzählen! Was die alles durchgemacht hatten! Aber eine Geschichte, die hat uns Kindern am meisten gefallen, und wir haben sie oft geplagt: „Mach, Seffe“ - Sophie hieß sie nämlich - „die Zehntnerkasse.“ Und da erzählte sie:
Das war damals – so fing sie immer an – als sie mit dem Napoleon noch stellenweise einig waren, zumindest die hier in Sachsen, und wohl auch der Preuße und der Österreicher, und auch welche von Preußen – sie sagten nur „die Schwarzen“ (Armee des Parteigängers vom Herzog von Braunschweig) – die haben sich hier oben im Gebirge zusammen herum gejagt, bald waren die obenauf, bald jene. Nun, es mag am 3. Juli 1809 gewesen sein, will sich doch mein Potvetter (Nenn-Onkel), der damals auf dem „Rappolt“ (Schacht) eingefahren ist, gegen vier Uhr früh gerade fertig zum Weggehen machen, da hörte er von der Straße her Getrampel einen Spuk, dass er gar nicht schnell genug das Fenster auf bekam, um den Kopf raus zu stecken und zu sehen, was da draußen los ist. Er wohnte in der Grießbacher Gasse in seinem kleinen Häuschen, wo man im Vorbeigehen zum Schornstein hinein spucken konnte.
Wie er nun zum Fenster raus schaute, mein Nenn-Onkel, kommt vom Tor her eine Reitertrupp die Gasse vor geritten. Das waren solche „Schwarze“, die von Zwickau herauf kamen. Was sie hier wollten, das konnte man gleich erraten als sie den Schwiegervater fragten, wo das Bergamt sei. Der wusste sofort um was es ging und sagte: „Ein Bergamt gibt es hier nicht, nur einen Bergmeister, und da müsst ihr zum Markt reiten, dort wohnt er“ - was aber gar nicht stimmte. Als er ihnen das gesagt hatte, wollte er den Kopf wieder aus dem Fenster nehmen, aber – soll man es für möglich halten! - eh er drinnen war, griff der, mit dem er geredet hatte, vom Pferd runter und reißt meinem Nenn-Onkel, der ein starker Raucher war, seine Pfeife aus den Zähnen raus, dass er dachte, das Feuer fliegt ihm in die Augen. Mein Nenn-Onkel war aber nicht der Feinste und der hat nun wie ein Rohrspatz geschimpft, aber der „Schwarze“, der hat nur gerade aus gelacht. Und als er davon galoppierte, hat er die Tabakbüschel nur so raus gerissen aus der Pfeife und hat meinen Nenn-Onkel noch zum Narren gehalten. Nun, der hat keine schlechte Wut gehabt und hat bei sich gedacht: Nun, warte nur, euch werde ich schon ausbrennen, ihr preußischen Lügenluder! Hat sich schnell völlig angezogen und ist fort gegangen. Wenn er auf seinem Weg nach der Grube einen kleinen Umweg macht, kann er am Haus des Bergmeisters vorbei gehen, der im Kuttelhof wohnt. Wenn es auch ein wenig zeitig ist, hat er bei sich gedacht, den musst du aufwecken und ihm die Sache mit den Soldaten sagen, die nach dem Bergamt gefragt haben.
Der Herr Bergmeister Kabisch, der war aber auch ein Frühaufsteher, und so musste ihn mein Nenn-Onkel gar nicht erst wecken. Er war in seinem Garten und hat Blumen gegossen. Sie haben ein wenig gebischbert (geflüstert), mein Nenn-Onkel und der Bergmeister, und danach ist jener – was hast du, was kannst du – hinter den Mühlberghäusern fort gerannt auf Neustädtel zu. Er kam zum oberen Revier noch rechtzeitig an, so dass die Bergleute noch alle in der Betstube zusammen und auch gleich fertig mit dem Singen waren. Ein Knappe musste gleich hinüber zum Priester-Stollen rennen und auch von dort die Leute holen. Sie sollten nur alle ihr Gezäh (Werkzeug der Bergleute, Hammer und Schlegel) mitbringen. Und hier auf dem Rappoolt-Schacht mussten auch alle alles einsacken. Die Zimmerleute ihr Beile und Äxte und die Maurer und die Hauer auch, und danach sind sie alle miteinander fortgezogen, mein Nenn-Onkel vorneweg.
Inzwischen war einiges in der Stadt vor sich gegangen. Es hat ein wenig gedauert, bevor der Hauptmann der „Schwarzen“ so zeitig früh richtige Weisungen bekommen hat, wohin er sich wenden soll. Er hat dauernd nach der Zehntnerkasse gefragt, das hätte ihm ja schon längst jemand verraten werden können, aber es konnte ihm keiner so richtig Bescheid geben. Aber endlich gaben sie ihm den Rat, zum Bergmeister zu gehen. Der Hauptmann, oder Leutnant, oder was er nun war, hat seine Leute mit den Pferden im Gasthof „Ring“ untergebracht und ist mit seinen zwei Korporalen runter zum Bergmeister geritten. Nun, der alte Bergmeister Kabisch, der wusste schon, was die Stunde geschlagen hat. Er hat den Offizier ganz freundlich aufgenommen und ihn gefragt, was er will. Der hat wieder von der Zehnterkasse angefangen, und dass er wüsste, dass Geld drinnen wäre und das es dem Staat gehöre, und das müsste er, der Hauptmann, mit seinen Leuten holen. „Nun“, sagte der alte Kabisch, „das ist schon richtig, das Geld vom Quartal Reminiscere und Trinitatis soll nächste Woche nach Dresden geschickt werden, das ist schon drinnen in der Kasse, aber leider kann ich Sie nur nicht gleich da hinein führen, Herr Leutnant, ich habe nämlich nur einen Schlüssel für die große eiserne Türe, den anderen hat der Zehntner Hasse, und den müssen wir erst holen lassen, sonst bringen wir die schwere Türe nicht auf, da werden Sie sich wohl etwas gedulden müssen.“
Nun, da soll er nur gleich hin schicken und den Schlüssen holen lassen, meinte jener. „Ei, freilich“, sagte der Bergmeister, machte die Türe auf und ruft: „Hahner!“ - „Da bin ich schon, Herr Bergmeister!“ schrie der. „Lauf mal geschwind rauf zum Zehntner Hasse, er soll nur gleich mit dem Kassenschlüssel kommen, die Preußen verlangen das Geld.“
„Gut, Herr Bergmeister!“ sagte der Hahner und zwinkerte mit de Augen, er wusste schon, dass die Sache nicht so dicht am Feuer angerichtet war, wie man so sagt, und er machte sich sofort auf den Weg. Der Herr Bergmeister hat aber immer mal zum Fenster raus geschaut, ob sich nichts regt, denn er wusste ja, was er mit meinem Nenn-Onkel ausgemacht hatte. Auf einmal sah er sie vom Mühlberg runter kommen, nichts als Bergleute und Arschleder, etwa an die zweihundert Mann kamen da angelaufen. Vornweg ein paar handfeste Bergschmiede, die hatten große Eisenstangen in den Händen, mit denen sie den Kirchturm umschmeißen könnten. Und dahinter so ein dreckiger Fleck Bergleute in ihrem Anfahrtszeug, und jeder mit etwas zum Zuschlagen in der Hand. Der eine hatte einen großen Feustel, der andere eine Spitzhacke, der dritte einen Feuerhaken; etliche hatten auch ihre Paradehacke mitgebracht, die sie tragen, wenn Bergaufzug ist. Die kamen nun alle zusammen auf das Haus zu, und man hörte sie ihr Glückauf schreien, das hat aber nicht garstig geklungen.
Nun öffnete mein Bergmeister das Fenster nd sagte zu dem preußischen Offizier: „Herr Leutnant“, sagte er, „da wird von der Zehnterkasse nicht gar zu viel für Sie er, denn die Bergleute da unten – schauen Sie mal zum Fenster raus - , die wollen gerade ihren Lohn aus der Kasse holen.“ Der Offizer schaute auch mit zum Fenster raus, sah sich die Bescherung an und dachte bei sich: mit den fünfundzwanzig Mann im „Ring“ und den zwei hier wirst du freilich nicht viel ausrichten können. Und der Zehntner Hasse, der gerade mit dem Schlüssel anrückte, meinte das auch. Sie waren in großer Eile, die Preußen, denn wie man später hörte, sind die Sachsen und die Franzosen schon von Chemnitz her auf Zwickau angerückt gekommen. Da hat der Offizier einen schiefen Mund gezogen und ist mit seinen beiden Korporalen fort geritten. Und weil er sah, keine Anstalten zum Fortgehen machten, sind sie alle zusammen wieder auf Zwickau abmarschiert.
Hätte der Dingerich (Kerl) nicht so ungehobelt meinem Nenn-Onkel seine Pfeife aus dem Mund raus gerissen, dadurch der erst solche Wut bekam, wer weiß, ob er zum Bergmeister gerannt und die Zehnterasse gerettet worden wäre.
* * *
Max Wenzel
Max Wenzel (* 8. April 1879 in Ehrenfriedersdorf; † 4. September 1946 in Chemnitz) gehört mit zu den bekanntesten und Mundartdichtern des Erzgebirges. Nach dem Besuch des Lehrerseminars in Annaberg wurde Max Wenzel Hilfslehrer in Wiesa. Seinen Militärdienst leistete er beim Infanterieregiment Nr. 134 in Leipzig. Danach war er als Lehrer in Geyersdorf und Grumbach tätig, bis er eine Anstellung in Chemnitz fand, wo er bis zu seinem Tode in der Hugenbergstraße 55 lebte. In Chemnitz lehrte Max Wenzel in der André-Schule zusammen mit Otto Thörner, welcher ebenfalls Lehrer, Lyriker und Heimatdichter war. Wenzel zählt neben Anton Günther zu den produktivsten Mundartdichtern des sächsischen Erzgebirges. Allein 11 Bände der Erzgebirgsbücher stammen aus seiner Feder.
Sieben Jäger
(Siebn Gager)
Es war einmal im Winter oben in der Marienberger Gegend bei der Rätzer-Brettmühle, als der Stülpner-Karl einen großen Hirsch geschossen hatte. Er holte sich zwei von seinen Kameraden, die ihm helfen sollten, das Tier auszuweiden und wegzuschaffen. Es wurde fachgerecht zerlegt und die Stücke in Säcke verpackt. Weil die böhmische Grenze nicht weit weg war, wollten sie den Haufen Säcke hinüber schaffen. Dort hatten sie einen Vertrauensmann, der den Verkauf besorgte. Sie hatten nun jeder gerade seine Sack auf den Rücken und die Reise sollte los gehen. Sie waren kaum einen Büchsenschuss weit gegangen, da kamen auf einmal sieben Jäger. Die hatten für den Rittergutshof einen Wildbraten zu schießen und hatten alle ihre Knalleisen (Gewehre) mit. Die hatten kaum den Stülpner gesehen, als sie auch schon an eine große Belohnung dachten, die auf seinen Kopf ausgesetzt war, und sie wollten etwas Jagd auf ihn machen. Sie dachten auch, sieben gegen drei – die Sache müsste funktionieren. Aber sie hatten sich doch etwas verrechnet. Denn kaum hatte sie der Stülpner entdeckt, da flog auch schon der Sack von seinen Schultern runter und seine Flinte war angelegt. Auch die beiden anderen Wilddiebe hatten ihr Zeug weggetan und die Gewehre in den Händen. Der Karl ging ohne Furcht auf die Jäger zu. So waren die in ihrem Leben noch nicht angedonnert worden, wie das jetzt der Karl mit ihnen machte: „Halt! Was wollt ihr denn hier?“
Wenn es halbwegs gegangen wäre, hätten sich alle sieben in ein Mauseloch verkrochen. Aber der Grenzschützer Liebeskind fand zumindest seine Sprache wieder und sagte, als müsse er sich entschuldigen: „Wir dachten es wären Holzdiebe im Revier.“ Und der Revierbursche Müller setzte gleich dazu: „Wir hatten gedacht, es wären Schmuggler da.“ Da lachte mein Stülpner recht huhnackig (=hohnneckig) und schrie sie an: „Ach so, ihr seit Tabaksbüttel!, Na, da beruhigt euch nur. Bei mir findet ihr keinen Tabak, keinen Zucker und einen Kaffee! Ich bin kein Holzdieb! In unseren Säcken, da ist Wildpret, das kann euch aber als Tabaksbüttel gar nicht interessieren! Aber wisst ihr: da könntet ihr auch eure Schießeisen einmal hinlegen, die braucht ihr doch nicht. Ich werde die schleppen und ihr tragt dafür meine Säcke bis nach Reitzenhain!“ Was wollten die Jäger sagen? Sie sahen die Gewehre auf sich gerichtet, die bei jedem falschen Griff los gehen konnten, und vorm Karl hatten sie sowieso Angst. Sie legten die Flinten weg und ließen sich die Säcke aufhängen. Die Wilddiebe nahmen die Gewehr und hängten sie sich um, aber die eigenen Flinten behielten sie geladen in der Hand. Der Karl kommantdierte: „Vorwärts, marsch!“, und die Reise konnte los gehen. Als sei glücklich über der Grenze an gekommen waren, durften sie ihre Lastren ablegen. Der Karl gab ihnen ihre Gewehre wieder, lies sie aus seiner Korbflasche einen tüchtigen Schluck nehmen, sagte einen recht herzlichen Dank und „Guten Weg“ und ging mit seinen Spießgesellen in den Wald. Die Jäger aber zogen recht betäppert nach Hause und ihre Herrschaft musste sich heute ohne Wildpretbraten behelfen.
Auch richtig!
(Aa richtig!)
Der Lehrer wollte mit den Kindern über die Geduld sprechen. Er sagte: „Passt mal auf, wenn der Herr Erbrichter fischen geht. Stundenlang geht er am Wasser hin und her. Und wenn er auch nicht gleich eine Forelle fängt, er wird nicht böse, immer wieder wirft er die Angel ins Wasser. Was braucht er dann zum Angeln?“ Da flogen an die zwanzig Hände in die Höhe. „Nun?“ „Würmer!“ schrie die halbe Klasse.
Der Teufel im Frohnauer Hammer
(Der Teifel in Frohnaer Hammer)
Der Teufel – Gott hab ihn selig – hatte mein Tag mit seinem Eintreffen in der Annaberger Gegend nicht besonders viel Glück gehabt. Der Katzenmühle in Buchholz ging er aus dem Weg wo er nur konnte, und die spitzen Krallen von dem Bären damals, die fühlt er jetzt noch in seinen vier Buchstaben. Mit seiner Liebschaft, der schönen Kathl, war es auch schief gegangen. An den Kathlststä (Käthelstein) traut er sich auch nicht mehr ran, er dachte nämlich, dass ihm wieder das heilige Kreuz in den Weg kommt. Kurz und gut, er ließ sich in der gesamten Gegend nicht mehr sehen. Als er nun wieder einmal in der Hölle Feuer machte, da kam seine Großmutter dazu. Die hatte kaum ein bisschen zugeschaut, da gab sie ihm schon einen Schups, dass er bald in den großen Höllenofen hinein geflogen wäre. „Das wäre mir ein Feuer, du dämlicher Kerl! Bei der kleinen Flamme müssen sic h doch die armen Seelen vorkommen, als säßen sie zu Haus e auf der Ofenbank! Nein! Rein gekachelt wird! Rein geblasen wird! Dann wird es erst ein Feuer, wie es sein soll!“ Der Teufel hat gleich noch einen alten Stock zerhackt und Späne daraus gemacht. Dann ist er unter die Erde in Richtung Zwickauer Gegend gegangen und hat sich ein Steinkörbchen voll Kohlen geholt. Also, mit dem Reinkacheln hatte es keine Not. Auch das Reinblasen funktionierte. Da nahm er den Windmüller aus den armen Seelen und der musste Wind machen, dass bald ein Feuer im Ofen brannte, an dem kein Weib und nicht mal dem Teufel seine Großmutter daran was auszusetzen hatte. Nun wollte er aber alles genau so machen, wie man es ihm gesagt hatte und er suchte etwas zum Schüren. Aber es war zum Teufelholen, die Schüreisen waren alle zu kurz. Er lief gleich zur Großmutter und klagte ihr seine Not. Die hatte ein Einsehen und sagte: „Mach dich hoch und seh´ zu, wo du ein langes Schüreisen her bekommst!“ Mein Teufel nahm sich noch seinen ledernen Rucksack mit, worin er manchmal ein paar armes Seelen heimbrachte, und machte sich auf den Weg. Er überlegte hin und her, wo er ein solches Eisen her bekommen könnte. Er hat sich da oben auf der Erde erkundigt, bis ihm jemand sagte, er müsste zu einer Hammerschmiede gehen. Da fiel ihm ein, nicht weit vom Kathelstein in Frohnau, da war doch ein Hammer. Und weil er die Gegend kannte, dachte er: „Dort gehste hin!“ Ein wenig schummrig war ihm schon zu Mut, denn von dort hat er noch nicht viel Gutes erfahren.
Im Frohnauer Hammer waren sie gegen Abend schon beim Aufräumen, als es noch einmal klopfte. Der alte Hammerschmied sagte zu seinen Gesellen: „Seht mal raus, wer draußen ist!“ Der Gottlieb machte sich also an der Türe zu schaffen. Es dauerte nicht lang und er kam wieder. „Das sind aber paar komische Hosen, die da draußen stehen!“, sagte er. Da wurde der Gottlob auch neugierig und ging zur Türe. Der kam nun wieder brachte das Ding mit was da draußen gestanden hatte. „Dass Gott erbarme“, sagte der Meister, „was bringst du denn da für ein Wurzelbild?“ Der Teufel trat nun ein wenig großspurig auf, wie das so seine Mode ist: „Was ist denn das für eine Sache, einen solange draußen stehen zu lassen?!“ Hammerschmiede sind nicht so leicht aus der Ruhe zu bringen. Der Meister sagte nur: „Was willst du denn?“ „Ein Schüreisen brauch ich! Drei Ellen lang und zwei Zoll stark.“ „Weiter nichts?“ sagte der Meister. „Nee, aber es muss gleich gemacht werden“, sagte der Teufel. Die drei Schmiede wunderte sich und guckten sich den Dingerich (komische Figur) ein wenig von der Seite an: „Wozu braucht ihr denn so ein langes Schüreisen?“ fragte der alte Schmied. Da lachte der Teufel recht höhnisch und sagte: „Wir haben eben einen großen Ofen! Du wirst ihn schon noch zu sehen bekommen!“ Mittlerweile war der Gottlieb mit sich ins Reine gekommen. Er winkte den Gottlob heimlich zu sich her: „ Das ist niemand anders als der leibhaftige Böse“, sagte er, „schau nur hin: auf einem Bein hinkt er, oben an der Mütze sieht man, wie sich die Hörner abdrücken, und das Luder stinkt wie der blanke Schwefel! Sag´s mal dem Meister, ich will inzwischen anfangen, das Feure wieder anzurühren!“ Der Gottlob hat nun dem Meister die Sache heimlich gesagt und der nickte mit dem Kopf. Wenn drei Hammerschmiede sich über ein Viertes einig sind, dann Gnade Gott dem Vierten!
Dem Teufel ging alles zu langsam. „Los, los! Feuer anrühren!“ schrie er. Es waren noch ein paar nicht glühende Kohlen auf dem Schmiedefeuer, und mein Teufel wollte rein blasen, damit es schneller ging. Aber kaum war er mit dem Mund ein wenig dran, da zog der Gottlob den Blasebalg so, dass meinen Teufel das halbe Feuer um das Gesicht spritzte. Er fluchte gerade heraus, aber der Gottlob sagte: „Was hast Du denn? Du hast dir wohl die Gusch (Mund) verbrannt? Ja, hier darf man die Nase nicht so weit ran halten!“ Jetzt suchte der Schmied noch ein Eisen, dass passen könnte, und mein Teufel wollte sich inzwischen etwas nieder setzen. „Setz´ dich dort hin“, sagte der Gottlob und zeigte auf ein paar graue Stangen. Aber kaum hatte sich der Teufel hin gesetzt, da sprang er wieder auf. Die Stangen waren doch noch ganz heiß, es war nur ein wenig grauer Schorf darüber. Er hielt sich mit allen beiden Händen sein Hinterviertel und sprang dort herum wie ein verrückt gewordener Spatz. „Ist dir wohl nicht gut?“ fragte der Meister. Aber der Teufel gab keine Ruhe. Er fluchte, wie eben nur der Böse fluchen kann, bis die Hammerschmiede die Sache satt hatten. „Wenn du nicht ruhig bist“, sagte der Meister, „da stoppen wir dich in deinen Rucksack rein, darin wirst du dann schon zur Ruhe kommen!“ Und wie mein Teufel immer weiter krakeelte, schnappten sie sich ihn zu dritt, steckten ihn den Sack und wollten ihn auf dem Amboß legen und den Sack mit ihren Schmiedehämmer etwas breit klopfen. Aber der Meister sagte, das ginge nicht, sie könnten ihm dabei etwas zerbrechen. Und der Teufel müsste sein, wer soll denn sonst die bösen Menschen holen?
Die beiden Gesellen hätten ihm aber zu gerne noch etwas ausgewischt. Bis der Gottlob sagte: „Weißte, wir werden ihn noch ein wenig beruhigen, damit er nicht wieder kommt!“ Und da haben sie den Ledersack in den Mühlgraben getaucht. Nichts ist dem Teufel so zu wider wie kaltes Wasser. Er hat darum gebettelt und gebettelt, sie sollten ihn nur raus lassen, er wolle ihnen auch etwas zu Gefallen tun. „Gut“, sagte er, „wir lassen dich wieder raus. Aber du musst versprechen, dass du alle Hammerschmiede aus der Hölle raus lassen willst!“ Na, gut, was wollte der Teufel machen? Er musste es versprechen. Da haben sie ihn wieder aus dem Sack raus gezogen. „Gebt mir nur wenigstens noch ein Schüreisen mit, sonst bekomme ich von meiner Großmutter noch eine Ohrfeige!“ jammerte er. Die Schmiede lachten und haben ihm noch eine Stange – vier Ellen lang und vier Zoll lang – aufgeladen. Mein Teufel zog ab: „Das sag ich euch, in den Frohnauer Hammer komme ich im Leben nicht wieder!“. Und er hat bis heute sein Versprechen gehalten.
Vom alten Gemeindevorstand X.
(Von alten Gemaavirstand X.)
In der Annaberger Amtshauptmannschaft war in einem Dorf vor vierzig Jahren der alte X. Gemeindevorstand. Er besorgte sein Amt recht und schlecht, wie er es eben konnte. Manchmal, wenn aus der Stadt einen Verordnung kam, fand er sich damit kaum zurecht, und da war jedes mal der Spuk und Ärger da. Es lag ihm nichts daran, solche seitenlangen Berichte zu schreiben. Er musste sich immer erst zwei- drei Mal erinnern lassen, bevor er sein Geschreibsel rein schickte. Dass die auf der Amtshauptmannschaft nicht gerade gut auf ihn zu sprechen waren, das kann man sich wohl denken. Nun kam einmal der Amtshauptmann durch das Dorf, wo der alte X. regierte und hielt mit seinem Landauer vor dem Gemeindeamt an.
Der alte X. kam raus, nahm seine Mütze ab und sagte: „Glück auf, Herr Amtshauptmann!“ Und bei sich dachte er: „Was wird der denn schon wieder wollen?!“
Der Amtshauptmann schaute meinen X. von oben bis unten an, dann sagte er: „Wie alt sind Sie denn, Herr Vorstand?“
„Also im Juli werde ich siebenundsechzig.“
„So, da fällt Ihnen wohl auch das Arbeiten recht schwer?“
„Aber nein, unsereins ist doch die Arbeit gewohnt!“
„Nun ich meine, ob Sie nicht einmal einer jüngeren Kraft Platz machen würden?“
„Aber wozu denn?“
„Es ist nur wegen der Gemeinde, damit die sich nicht einmal beschwert!“
„Ach, für die bin ich gerade recht!“
„Jaja, aber sehen Sie sich mal Ihren Kollegen im Nachbardorf an, da kommt alles pünktlich und richtig herein nach Annaberg. In seiner Gemeinde spricht man aber auch von ihm besser wie von Ihnen im hiesigen Ort!“
„Na, das will aber nicht viel heißen, Herr Amtshauptmann, so sind die Leute nun mal. Die Marienberger denken auch, sie haben einen besseren Amtshauptmann als die Annaberger!“
Da gab der Amtshauptmann seinem Kutscher einen Wink, er möge weiter fahren.
2.
Vom alten X. weiß ich auch noch eine Sache: Es war zu der Zeit, als die Hundesteuer eingeführt wurde. Die Bauern im Dorf vom X. waren so preußisch, dass sie den alten X. und noch einen vom Gemeinderat zum Amtshauptmann schickten, sie sollen den Leuten mal sagen, was die neuen Steuern für Dummheiten wären. Der Amtshauptmann hat sich alles angehört, dann sagte er aber, die Bauern brauchten eigentlich gar keine Hunde, sie hielten sich die doch nur zum „Luxus“, wie er sagte. Da fing aber der alte X. an! „Herr Amtshauptmann, ich will Ihnen mal was sagen. Wir Bauern haben viel Arbeit. Und wo viel Arbeit ist, möchten auch Mädchen sein. Wo Mädchen sind, sollen auch Freier sein. Wo Freier sind, wird auch Hochzeit sein. Wo Hochzeit ist, sollen auch Bettfedern sein. Wenn man Federn braucht, müssen auch Gänse sein! Und wo Gänse sind, müssen auch Hunde sein, denn wir Bauern können den Gänsen nicht selber hinten rein zwicken, wenn die ausreißen wollen!“
Die Ähnlichkeit
(De Ahnlichkät)
In unserem Haus wohnte einmal eine Witwe. Die hatte zwei Mädchen und einen Jungen. Die Mädchen waren schon aus den besten Jahren raus. Hatten sie noch schön ausgesehen, als sie jung waren, so waren sie mit den Jahren immer schlimmer geworden. Der Junge dagegen war ein flottes Bürschlein, man sah in zu gerne an. Da kommt einmal eine Marktfrau aus C. und hat was zu berichten. Wie es damals so Mode war, wird sie mit in die Küche genommen und bekommt eine Schale Kaffee. Dabei bekommt sie alle drei Kinder zu sehen. Sie trank ihre Schale Kaffee, dann sagte sie zur Mutter: „Also so was, so eine Ähnlichkeit! Die Mädchen sind ganz wie Sie! Und der schöne Junge ist wohl nach seinen seligen Vater geraten?“
Sonntagsruhe
(Sonntigsruh)
Half mir doch neulich im Dorf, wohin ich meine Sonntagspartie gemacht hatte, ein Junge den richtigen Weg zu finden. Es war ein aufgeweckter Junge, darum schenkte ich ihm einen Neugroschen. Er bedankte sich und steckte ihn ein. Ich fragte ihn: „Was machst Du denn mit dem Geld?“ Das hebe ich mir auf!“ sagte er. „Das machst Du richtig“, lobte ich ihn, „immer spare Dir Dein Geld, es sind jetzt schlechte Zeiten!“ „Ja“, fiel er mir in die Rede, „besonders heute am Sonntag! Da hat man nun mal einen Neugroschen und die Läden sind zu!“
Der ewige Arbeitsmann
(Der ewige Arbeitsmaa)
So lang ich denken kann war der Fichtner-Traugott ein rechtes Arbeitspferd gewesen. Und es war wie ausgemacht: Überall, wo er hin kam, da gaben sie ihm die schwerste Arbeit. Er hat es auch willig gemacht und war alt und krumm dabei geworden. Und trotz allem Schuften hat er es zu nichts gebracht. Als sie ihn einmal krank und zusammengebrochen aus dem Steinbruch nach Hause brachten, da besuchte in auch mal der Pastor. Der Traugott wusste genau, wie es um ihn stand. Er sagte zum Pastor: „Schönen Dank“ für den Besuch, er solle sich aber keine Mühe geben, es ging mit ihm zu Ende. Der Pastor wollte ihn rösten, ihm tat der alte Mann leid. „Mein lieber Herr Fichtner“, sagte er, „ich weiß, dass Sie Ihr ganzes Leben lang haben schwer arbeiten müssen, schwerer als andere Menschen. Unser Herrgott wird Sie in jenem Leben dafür belohnen. Sie werden es bei ihm desto besser haben, gerade weil Sie auf Erden so schwer dulden mussten!“ „Daran glaube ich nicht, Herr Pastor!“, sagte mein Traugott. „Verlassen Sie sich drauf, Herr Fichtner, es gleicht sich im ewigen Leben alles aus“, redete ihm der Pastor zu. „Ich weiß schon wie das wird“, sagte der Traugott, „wenn ich oben angekommen bin, da wird es gleich heißen: Jetzt kommt der Fichtner-Traugott, der ist immer schwere Arbeit gewohnt gewesen, der kann donnern!“
Eine Diskussion über das Schnarchen
(E Dischkur über´n Schnarchn)
Neulich war ich mit meiner Alma einmal abends beim Erzgebirgsverein. Wie es so ist: Hüben saßen die Männer und drüben die Frauen. Wir Männer hatten erst ein wenig von diesem und jenem geredet, da merkte ich, dass unsere Frauen eine recht wichtige Diskussion haben mussten, da sie mit den Armen fuchtelten wie eine Pfarrhenne und sie ließen sich gegenseitig kaum zu Wort kommen. Da hörte ich auf einmal wie die Tante Rosel sagte: „Nu, meiner erst!“ ich stieß gleich meinen Freund Alfred ein bisschen an, denn es war doch anzunehmen, dass sie gerade über uns Männer herzogen. Die Lindner-Lina nahm gerade das Wort: „Und wisst ihr denn, wie es meiner macht. Erst rafelt er Töne raus, dass man denkt, er zerreißt eine alte Lederhose, dann fängt er an zu krächzen wie eine alte Krähe, dann bläßt er wieder, als wenn die Milch überlaufen würde. Und wen ich ihm einen Stoß gebe, dass er aufwacht, da wird er auch noch ekelhaft und schreit mich an, er hätte überhaupt nicht geschlafen! Und er schnarcht überhaupt nicht! Nun möchte ich um alles in der Welt ihn einmal hören, wie es klingt, wenn er wirklich mal schnarcht, wenn er schon mit offenen Augen solche Töne von sich gibt!“
Also um die Schnarcherei drehte es sich! Nun, ich muss gestehen, das ist nicht gerade ein schönes Kapitel für unsereins. Meine Alma behauptet steif und fest, ich würde schnarchen wie eine verrostete Sägemühle. Ich glaube das aber gar nicht. Denn wenn man so laut schnarcht, wie es die anderen sagen, da müsste man ja selbst davon aufwecken. Ja, ich kann mich sogar erinnern, dass ich mich mal selbst schnarchen gehört habe. Das klang aber so schön und sanft, dass gewiss niemand davon aufgeweckt ist. Unser Stubennachbar sagt zwar auch, man höre mich im ganzen Haus schlafen. Das ist aber nur eine üble Nachrede von dem. Meine Alma spricht immer: „Du bist zu dick, darum schnarchst du auch so!“ Als aber neulich der Großonkel Albin bei uns zu Besuch war und er sich zu Mittag ein wenig auf das Kanapee gelegt hatte, da ging eine Kantate los, dass man dachte, eine Feuerwehrkapelle hält eine Probe ab, so schnarchte der. Und dabei ist mein Albin so lang und dünn wie ein Bohnengerüst. Die Siegert-Olga sagte, bei ihrem Alten käme es vom Saufen. Das kann aber auch wieder nicht stimmen, denn es schnarchen auch solche, die nicht mit dem Bierbrauer verwandt sind.
Nun hat man schon allerlei Mittel erfunden, mit denen man das Schnarchen vertreiben will. Meine Alma rempelt mich immer an und spricht: „Leg´ dich nur mal auf die andere Seite!“ Das mach ich auch, aber es dauert nicht lang, da spricht sie wieder, ich soll ich herum legen. Mir scheint es, als klingt es auf der einen Seite schöner als auf der anderen. Es heißt auch, es würden nur die Leute schnarchen, die – mit Respekt gesagt – das Maul aufhalten beim Schlafen.
Aber da kenn ich welche, die pressen die Lippen aufeinander, damit kein Schnarcher raus kommt. Aber die knirschen mit den Zähnen, und das klingt noch viel gefährlicher! Wieder andere wollen wissen, dass es aufhört, wenn man ein Tuch über den Kopf legt. Na, eh ich aber ersticke, da höre ich mir doch lieber die Komplimente von meiner Alma an. Das geht schon früh los: „Aber du hast wieder einmal geschnarcht diese Nacht! Kein Auge konnte ich schließen! Und geträumt habe ich lauter solch ekelhaftes Zeug!“ Ich sagte da natürlich: „Na, wenn du geträumt hast, da musst du auch geschlafen haben! Oder träumst du mit offenen Augen?“ Und neulich stellte sie mal einen Topf Baldriantee auf den Tisch als ich gerade zu Bett gehen wollte. Das soll helfen, sagte sie. Nun, ich hab ihr den Gefallen getan und hab ihn getrunken. Das muss ich zugeben: Ich habe selten so gut geschlafen wie in der Nacht. Meine Frau hatte aber auch welchen getrunken. Und als ich sie früh fragte: „Nun, haste heute Nacht was gehört?“ Da sagte sie: „Ich weiß nicht, ich habe geschlafen. Aber geschnarcht wirst du schon haben!“ Da habt ihr´s! Sie hat es nicht mal gehört, aber geschnarcht hab ich trotzdem! Seitdem trinken wir alle beide eine Tasse Baldrian vor dem Zubettgehen, und das hilft. Mein Stubennachbar meint zwar, meine Alma soll nur einen großen Bottich kochen fürs ganze Haus, damit die anderen auch nichts hören. Aber das möchte ich eigentlich unserer Katze nicht antun, die ist so schon von dem bisschen Baldriangeruch ganz melancholisch geworden. Es steht aber fest: Das Mittel gegen das Schnarchen müssen immer die anderen einnehmen, das hilft. Denn, im Vertrauen gesagt: Ich trinke meine Tasse schon lange nicht mehr, weil mir das Zeug zuwider ist.
Da fällt mir gleich eine Geschichte aus meiner Jugendzeit ein. Da hatte einmal der Erzgebirgsverein seine Versammlung in Schwarzenberg und ich sollte für unseren Verein mit hin fahren. Für mich war das eine große Ehre, weil da nur immer die Putzobersten hin fahren durften. Also ich fuhr mit dem Schuldirektor, mit dem Doktor und mit dem alten Baurat nach Schwarzenberg. Als die Quartiere festgelegt wurden, sollte der Schuldirektor mit dem Baurat in einer Stube schlafen. Da warf aber mein Schuldirektor ein, dass er mit dem Baurat nicht schlafen könne, weil er so stark schnarchte. Nun, ich als der Jüngste sagte, ich wollte mit ihm schlafen, mich würde das nicht stören. Wie es nun so ist, wir jungen Leute kamen doch ein wenig später nach Hause als die alten. Als ich nun kin die Stube kam, lag mein Herr Baurat im Bett und schlief. Ich habe mich nun auch ausgezogen und niedergelegt. Als ich früh aufwachte, da trat mein Baurat ans Waschbecken und wusch sich. „Glück auf, Herr Baurat!“ sagte ich höflich. Aber da drehte sich mein Stubengenosse um und sagte ganz staubtrocken: „ Donnerwetter noch mal, Weißköppel-David, aber Ihr schnarcht in der Nacht! Ich hab die ganze Nacht kein Auge zugetan!“
Die Großen sind die Großen!
(De Grußen sei de Grußen!)
Damit meine ich nicht etwa solche langen Schlenkriche (Kerle), die aus der Dachrinne trinken können und die sich die Eiszapfen in die Augen stoßen – nein, ich rede von solchen Leuten, die etwas bedeuten. Wenn ich die alle aus unserem Gebirge nennen sollte, da würde ich wohl nicht fertig werden. Mit der Größe, das ist so eine Sache. Man hält so manchen Menschen für sonst was Apartes, und danach kommt heraus, dass gar nicht so viel daran gewesen ist. In Annaberg gab es vor vielen Jahren eine Sparkasse. Die war aber nicht von der Gemeinde eingerichtet worden, nein, das war eine Privatsache von einem großen Geschäftshaus. Schon der Großvater hatte die Sache eingerichtet, und es gab deswegen viele Leute, die ihre mühsam gesparten Pfennige hin schafften, schon weil sie dachten, dafür brauchten sie keine Steuern zu zahlen, weil die Stadt davon nichts erfährt. Auch Handwerker gaben den Leuten ihr Geld zum Aufheben. Und so ging es lange Zeit, bald ein paar Jahrzehnte lang. Der letzte, der die Kasse hatte, war ein großer, starker Mann mit einem großen Vollbart. Wenn der auf der Straße ging, dachte man, der Großmogul käme. Die Leute lebten auch fein und herrlich und in Freuden. Die Geschäfte mit der Schwarzarbeit waren gut gegangen, und in die Sparkasse kam viel Geld. Auf einmal starb der Mann. Es hieß, der Schlag hätte ihn gerührt. Selten hatte es ein solches Begräbnis gegeben wie dieses. Die ganze Stadt war auf den Beinen, auch vom Dorf waren sie herein gekommen. Und unter den ganzen Sperrguschen (neugierige Leute) waren ihrer viele, die ihr Geld in der Sparkasse angelegt hatten. Der Superintendent selbst hielt die Leichenrede – er stand auch im Sparkassenbuch – und sagte von dem Mann, er wäre der Wohltäter vom ganzen Erzgebirge, und alle Leute würden um den großen und auch guten Mann trauern. Die Gruft konnte die vielen Blumenkränze und Palmenzweige bald gar nicht aufnehmen, und der Totengräber Ahnert stand dabei und machte ein ganz trübseliges Gesicht, er hatte sein Geld auch dorthin geschafft. Wenn er schon alles gewusst hätte, wäre sein Gesicht noch trübseliger gewesen! Denn nach ein paar Tagen, da brach es aus! Es war kein Pfennig in der Kasse. Der feine Mann hatte jahrelang einfach von den Sparpfennigen, die die Leute brachten, gelebt – und nicht schlecht. Auch das mit dem Schlagfluss stimmte nicht. Er hat mit dem Strick ein wenig nachgeholfen. Um den Kerl war es schließlich nicht schade, zu bedauern waren nur die Leute, die ihre Pfennige eingebüßt hatten. Da gab es welche, die amen nicht darüber hinweg und nahmen sich das Leben. Andere wurden verrückt darüber. Kurz und gut, es war, wie die gelehrten Leute sagen, eine Katastrophe. Der aber all das angerichtet hatte, der lag unter seinem Blumenhügel und kümmerte sich um nichts. Er merkte ja nichts von dem Elend, das er hinterlassen hatte. Ich glaube, wenn diese Sache in einem Land passiert wäre, wo sie ein heißeres Blut haben als bei uns, da hätten sie die Kränze vom Grab runter gerissen. In Annaberg sind sie aber nicht so. Aber einen Denkzettel musste der Dingerich (Kerl) doch bekommen! Als der Totengräber Ahnert einmal früh zur Gruft kam, da stand dort ein Stock mit einem eingeklemmten Zettel. Auf dem stand:
Hier in dieser Gruft,
da schläft der größte Schuft.
Der Ahnert, der wird´s wissen,
den hat er auch be---trogen.
Beim Friseur (Wundheiler, Badeknecht, Bartschneider)
(Ben Balbier)
Schönheit vergeht! Dass das ein wahres Wort ist, weiß niemand besser als die Männer. Heute zum Sonntag bist du schön glatt im Gesicht, und lass nur paar Tage vergehen, da bist du wieder rau wie eine Kratzbürste. Wir hatten es in unserem Dorf nicht so bequem wie jetzt, uns das Gesicht glatt machen zu lassen. Wer sich rasieren lassen wollte, der musste erst eine Stunde in die Stadt laufen, dort war dann so ein Bartkratzer. Das war aber damals anders vor vierzig Jahren. Da wurde auf einmal beim Gasthof gegenüber ein großes Schild an das Haus genagelt, darauf stand zu lesen: „Barbier-, Frisier- und Haarschneidesalon“. Oh, Gott! In unserem Dorf ein Salon! Ich hatte mir darunter eigentlich etwas Großartigeres vorgestellt. Der neue Friseur Richter hatte in dem Häuschen doch nur eine Stube mit einem Alkoven gemietet. Wo da noch ein Salon herkommen sollte? Naja, es ging aber. Die Stube war eben, wie der Kantor mal sagte, ein „Universalraum“ Es war alles drinnen, wozu die Stadtleute eine ganze Etage brauchten. Es war Wohnstube, denn der Friseur Richter wohnte drinnen; es war auch „Damenzimmer“, denn seine Frau hielt sich auch mit darinnen auf; eine Kinderstube war es auch, denn die beiden Kleinen schrien dort herum; Küche war es auch, denn im Ofen wurde gekocht; als Speisezimmer musste sie auch dienen, denn im Alkoven hätten die Leute ja nicht gut essen können; Waschhaus war es auch und Wäscheboten gleich mit, denn die Richter-Friseurin wusch ihre Wäsche dort und hing sie an der Ofenstange auf. Nicht zu vergessen: Die Stube war auch „Rauchzimmer“, denn wer dort rein kam, der qualmte auch aus seiner Pfeife. Was aber die Hauptsache war, die Stube gab auch noch dem Friseur sein „Sprech-, Warte- und Arbeitszimmer“ ab. Man sieht daraus, dass eben mit ein bisschen guten Willen alles zu machen ist. Es hing auch ein großer Spiegel an der Wand, und davor stand ein großer Rohrstuhl mit so einem Ding, wo man den Kopf drauf legen kann. Ein Schränkchen hing auch dort, da lagen ein paar Stückchen Seife und paar Päckchen Bartwichse und etwa fünf Fläschchen mit Odokonollie (Parfüm: Eau de Cologne). Ein Schächtelchen war auch zu sehen, auf dem stand „Hühneraugenpflaster“. Am Fenster baumelten noch zwei Pappschilder, auf einem stand: „Neuzeitliche Fußpflege“ und auf dem anderen: „Zahnoperationen werden ausgeführt“. Also wir hatten uns im Dorf durch den Salon wirklich verbessert. Ja, die Friseurstube war sogar noch mehr, sie erhob sich zum „Dorfparlament“, wie der Kantor sagte. Was waren Reichstag, Landtag und Gemeinderat gegen Friseur Richters Stube?! Dort wurde alles beredet, was die hohe Politik betraf, auch die Philosophie wurde besprochen, und so einen geistigen Diskurs wie dort, hat es nicht einmal zu Doktor Martin Luthers Zeit gegeben! Der Gescheiteste war aber doch der Friseur Richter selber. Schon beim Einseifen ging es los. Wenn er mit dem Wetter fertig war, fing er mit was anderem an. Was im Wochenblatt gestanden hatte, das hat er den Leuten erst richtig auseinaderposementiert (erklärt, erläutert) und er gab natürlich seinen Senf mit Soße auch dazu. Ein solcher Friseur hat doch Glück! Der kann den Leuten sonst was erzählen, die müssen es sich ruhig gefallen lassen. Sagt mal was dagegen, wenn euch der Friseur dabei mit einem scharfen Messer an der Kehle rasiert!
Die ganze Woche über hatte mein Richter im Dorf nicht viel zu frisieren, da lief er mit seinem Lederkästchen in den Nachbardörfern herum. Aber am Sonntag, da ging es schon früh um sechs Uhr los. Da trat einer zum anderen. Jeder hatte sich eine blaue Schürze umgebunden, damit der Friseur keine Servietten brauchte. Die hatten auch alle Zeit, ja, es gab Kerle, die saßen den ganzen Vormittag dort beim Friseur, damit sie ja keine Neuigkeit verpassten. Leichtes Arbeiten hatte der Richter nicht. Wenn sie so ankamen mit ihrem struppigen Urwald im Gesicht, da konnte einem um das kleine zierliche Messer Angst und Bange werden. Ja, es gab auch welche, bei denen hätte man zum Friseur sagen müssen: „Nimm doch gleich den Tischlerhobel und hoble ihn damit glatt“ Mancher hat sich auf dem Marterstuhl auch gedreht und gewunden wie ein Regenwurm. Und als er aufstand, da sah er aus wie ein geschundener Raubritter. Und für diese ganze Schinderei bekommt er sieben Pfennige! Mit Haarabschneiden war es noch schlechter. Unsere Leute, die hatten doch Locken auf dem Kopf, dass die Schere kaum durchkam. Man hätte am besten eine Sense nehmen sollen. Wenn die Frauen dann zusammen kehrten, konnten sie damit ein ganzes Kanapee (Sofa) ausstopfen. Der Friseur sagte selber: „Die Kollegen in der Stadt sind besser dran, erstens bekommen sie für Haarschneiden dreißig Pfennige, wo ich nur fünfzehn kriege. Dann haben die auch nur ein viertel Teil zu schneiden, da die Stadtleute doch keine Haare auf dem Kopf haben!“ Dafür brauchte unserer Richter auch keinen Gehilfen, denn wenn das Geschäft mal recht gut ging, dann musste seine Frau beim Einseifen helfen. Unsere Leute waren auch nicht so versessen darauf, sich nach der neuesten Mode frisieren zu lassen. Wie es jetzt die Männer haben wollen, einmal vorne lang und hinten kurz, und einmal vorne kurz und hinten lang, das kam nicht so darauf an.
Es machte dem Richter-Friseur auch nichts aus, wenn er mal Doktor spielen musste. Er sagte immer: „Einen solchen Zahn raus ziehen, das ist wirklich Arbeit! Da muss man sich paar Stunden anstrengen und man bekommt nur fünfzig Pfennige dafür.“ Dass die Leute so gerne in dem Salon sitzen blieben, war wirklich verwunderlich. Wenn man bedenkt, was alles in dieser Stube vor sich ging. Was da für Wohlgerüche aufstiegen! Man hielt es wirklich nur aus, wenn man sich eine Pfeife anbrannte. Der Richter-Friseur brannte auch manchmal ein Räucherkerzchen an, das deckte dann so manches zu. Der kleine Lehrer, der gern schmutzige Witze machte, hatte einmal gesagt, es müsste einmal jemand fürs Grammophon Geruchsplatten erfinden, da könnte man Geld verdienen, denn mit einer solchen Platte vom Richter-Friseur seiner Stube, da könnte man ganze Häuser ausräuchern, da kämen auch keine Motten und solches Zeug mehr zum Vorschein.
Jetzt ist alles anders geworden. Jetzt hat mein Richter wirklich einen Salon, schon wegen der Sommerfrische. Seine Frau seift nicht mehr ein, jetzt treten außer dem Richter noch ein Gehilfe und ein Lehrjunge dort herum. Am Sonntag muss man aber mit den Bartstoppel herum laufen. Wenn man die Woche über rein kommt, da wird man höflich begrüßt. Erst spricht der Chef: „Guten Morgen, Herr Nachbar!“ Dann kommt der Gehilfe: „Guten Morgen, Herr Nachbar!“ Und zuletzt kommt das Echo vom Lehrjungen: „Guten Morgen, Herr Nachbar!“ Drei Stühle stehen dort. Aber man kann nicht unterscheiden, ob eine Frau oder ein Mann dort sitzt, denn jetzt gehen auch die Frauen zum Friseur. Es wartet auch niemand mehr gern: Fast jeder spricht, er hätte nicht viel Zeit, er wollte mit dem Zug fort! Und vornehm wird man bedient. Dieser Tage sagte der Gehilfe mal zu mir, als er mich frisierte: „Haben Sie Gefühle?“ Ich wusste erst nicht, was ich sagen sollte, dann meinte ich: „Ach ja, es geht mir so im Magen herum!“ Und wenn man geht, dann wird man vom Lehrjungen abgebürstet, auch dann, wenn nur einen alten Arbeitskittel an hat.
Jaja, es ist schon so, wie ich es mal bei meinem Jungen im Lesebuch gelesen habe: „Das Alte stürzt, es ändert sich die Zeit, und neues Leben blüht bei den Friseuren!“ (Mundart: „Das Alte sterzt, es ännert siech de Zeit, un neies Laabn blüht bei dann Balbieren!“)
Die Pyramide
(De Peremett)
Dass es vor Weihnachten sehr viel zu tun gibt, braucht man wohl nicht erst groß breitzutreten. Schon was die Frauen so zu häkeln und zu sticken haben, ist kaum zu sagen. Und die Heimlichtuerei dabei! Und was bloß vor Weihnachten für Petroleum unnötig verbrannt wird. Man möchte sagen: Die Nacht wird zum Tag gemacht. Der Vater will am Abend die Puppenstube frisch tapezieren. Das kleine Mädchen hat aber etwas davon bemerkt, und natürlich – sie will nicht ins Bett, denn die Neugierde lässt ihr keine Ruhe. Nun wird zugeredet und gelogen, zuletzt muß der Rupprich (erzgebirgischer Weihnachtsmann) herhalten. Dauert es dem Vater dann doch zu lang, da fängt er an zu schimpfen, das kleine Mädchen an zu weinen, und endlich packt sie die Mutter und schafft sie raus in den Alkoven. Nun ist ruhe und der Vater kann anfangen. Was überhaupt vor Weihnachten für Lügen gesagt werden und für Schwindel gemacht wird, das ist großartig. Die Frau traut ihrem Mann nicht, der Mann nicht der Frau. Ins Gesicht rein tun sie so, als wollten sie gar nicht wissen, was sie bekommen, hat aber einer nur mal den Buckel gewendet, geht das Stöbern los. Das darf natürlich der andere nicht wissen, und die Lüge ist fertig. Man sagt immer, die Großen sollen den Kindern mit gutem Beispiel voran gehen. Ja, schaut nur hin, vor Weihnachten sind die Großen oft schlimmer als die Kinder. Und da spricht man noch von einem „heiligen“ Christfest! - Aber das schönste Fest ist es doch. Nicht allein deswegen, weil man was bekommt, das hat für den Vater so wie so nicht viel zu bedeuten, der muss am Ende ja doch bezahlen. Auch die Butterstollenbäckerei macht´s nicht, man hat ja am Ende nur Bauchweh davon. Nein, alle was so drum und dran hängt. Was für ein schönes Vergnügen ist es doch, wenn man seinen Winkel oder Christgarten aufbauen kann! Oder wenn man in den Papierladen wegen Modellierbogen läuft. Und dann das Kleben und Basteln. Man fühlt sich doch wieder wie ein Junge, ja, man kann ruhig sagen, manchmal macht die ganze Sache mehr Vergnügen wie danach den Kindern, denn die möchten sich schon ein wenig in Acht nehmen, damit sie nichts zerbrechen, kaum angreifen sollen sie das Zn eug.
Nur der Gastwirt zieht ein schiefes Gesicht, denn die kommen jetzt kaum vorbei, die sonst ihr Glas Bier und einen Schnaps trinken. Im Gesangsverein kommen sie kaum zur Singstunde, es ist manches Mal Not am Mann, um einen Doppelkopf zusammen zu bringen. Auch die Turner haben zu Hause zu tun. Nur die Letzte Woche vor den Feiertagen heißt es antreten, denn da soll doch für die Aufführung am ersten Feiertag noch einmal eine Probe sein. Und warum das alles? Ja, wenn das Fest vorbei ist, wissen sie es selber nicht, und sie sagen auch: „Nächstes Jahr wird nichts gemacht!“ Wenn aber die Zeit ran ist, geht’s akkurat wieder so los.
Dass meine beiden großen Jungen etwas im Schild führten, hatte ich schon lange bemerkt. Wie oft wurde mir ein Neugroschen oder ein Fünfer weggenommen. Jedes mal hieß es, sie wollten es für Weihnachten sparen. Die ganzen Kugeln, die sie bei den anderen Kindern gewonnen hatten, wurden verkauft, zehn Stück für einen ganzen Pfennig bei den abgeschabten, für die „neuen“ bekamen sie einen Sechser. Wenn die Kaufleute manches Mal so gewusst hätten, was da alles gehandelt wurde – und bei den Preisen – die hätten vor Ärger ihren Laden zu gemacht! Dann standen die Jungs zum größten Verdruss der Dienstmänner am Bahnhof herum, und es glückte ihn doch manches Mal, dass sie einen Koffer zu tragen bekamen, und da war schon wieder ein Neugroschen verdient. Auch die Mangel drehen sind sie gegangen. Kurz: Man konnte denken, sie wollten das Haus verkaufen, so wurde das Geld zusammen geschmissen. Dass sie wirklich etwas Großes vor hatten, merkte ich am meisten daran, als sie im Oktober die Kuhnickel (Kaninchen) verkauften, da war auch etwas Be...trug dabei. Die Franzosen mit den lange Hängeohren sind doch etwas teurer als die anderen Hasen. Was machten die Luder? Sie hängten ihren Hasen Steine an die Ohren, damit sie länger werden. Das hab ich aber nicht zugelassen.
Unter ihrem Bett hatten sie einen Kasten mit einem großen Schloss dran. Kein Mensch wusste, was sie da drinnen hatten. Jeden Nachmittag, wenn sie aus der Schule kamen, wurde die Kiste mit, großer Mühe in den Schuppen hinüber getragen, und dann hörte man sie hämmern und sägen. Jede Minute fehlte mir etwas in meiner Schreibstube, einmal das große Lineal, mal die große Pappschere. Das Gummifläschchen bekam ich überhaupt nicht mehr zu sehen. Brauchte man zu Hause mal einen Hammer, da hieß es jedes Mal: „Die Jungs haben ihn!“ Einmal kam ich dazu, wie sie alle beide von meiner Frau ein paar tüchtige Ohrfeigen bekamen. Sie bleiben aber dabei ganz ruhig, daran konnte ich erkennen, dass meine Frau recht hatte. „Da, schau nur her, diese Schweineigel,“ sagte sie, „das ganze Haus voll grüner Farbe. Und es ist auch noch Ölfarbe, die geht nicht wieder raus! Da können die wohl nicht ihrer Bauerei warten, bis sie eine n andere Hose angezogen haben. Nein, gleich im Schulanzug geht’s los!“ Na, schließlich wurde für einen Neugroschen Terpentin geholt, und die beiden Jungs haben gerieben, dass ich dachte, sie würden Löcher rein reiben. Aber die Flecken waren raus.
Man wurde wirklich im ganzen Haus neugierig, was die eigentlich da machen. Drei Wochen vor Weihnachten nahmen sie den Schlüssel vom Schuppen weg. Das einzige war, dass sie die Kohlen immer rüber tragen mussten, sonst hätte keiner gehen wollen, aber jetzt machten sie das von ganz alleine, nur, damit niemand anderer in den Schuppen kam. Und das wunderbarste war: Nicht ein einziges Mal zankten sie miteinander, man sah richtig, wie die Heimlichtuerei sie zusammen hielt. Vierzehn Tage vorm Heiligen Abend sagten sie: „Vater, dürfen wir heute mal alleine gehen?“ Ich fragte natürlich. „Wo wollt ihr denn hin?“ „Nach Schimpfeld (Schönfeld)“, sagten sie, wir nehmen aber den Paul (was der Kleinste war) nicht mit!“ Na, ich dachte, willst ihnen die Freude nicht verderben und ließ es zu. Natürlich sollten sie sich warm anziehen und noch Mittag essen, damit sie fort kommen bevor der Kleine was merkt. Nun weiß ich nicht, ob sie in ihrem Stolz etwas gesagt hatten, oder ob der Kleine gescheiter war als die Großen: Gleich nach dem Essen, als sie fort wollten, setzte der Kleine seine Wintermütze auf und wich den Großen nicht von den Fersen. Na, ich dachte, wie werden sie den wohl los werden? Auf einmal ging in der kleinen Kammer ein Geschrei los, als wenn einer am Spieß steckt. Die Großen hatten den Kleinen dort eingeschlossen und waren auf und davon. Mich kostete die Ausreisserei einen Fünfer, denn ehre hörte der Kleine nicht auf zu schreien. Nun waren die dummen Jungs in Filzsocken los und hatten auch die Handschuhe liegen lassen. Als ich um sechs in die „Gans“ ging, um ein Glas Bier zu trinken, kam der Pilz-Luis aus Ehrenfriedersdorf. „Du, deine Jungs hab ich in Schönfeld beim Löwengut aufgelesen, die waren dir wohl ausgerissen? Na, ich hab sie mit auf den Schlitten genommen.“ „Das wird schon richtig gewesen sein“, sagte ich, „ich möchte nur wissen, was sie in Schönfeld wollten?“ „nun sie werden Männeln gekauft haben im Löwengut, ein recht großes Päckchen schleppten sie mit. Ich will mir ja auch für meinen Winkel ein paar neue Bergleute kaufen, die alten sind voll Wachs getropft“, sagte der Pilz-Luis, was mein Schwager ist. Ich war froh, dass die Jungs wieder da waren. Als ich nach Haus kam, war meine Frau noch außer sich. Ganz blau an den Händen und im Gesicht waren sie wieder gekommen. Der Kleinst hatte erst geschrien, sie hatten ihm aber einen kleinen Pappmaché-Hasen mitgebracht, den hat er mit ins Bett genommen und hielt ihn fest, damit er ja nicht ausreißt.
Ist es schon an den letzten Tagen vor Weihnachten mit den Kindern kaum auszuhalten, da konnte einem mit meinen beiden Großen bald die Galle über laufen. Am Tag saßen sie im kalten Schuppen und in der Nacht konnten sie nicht schlafen. Ich merkte ganz genau, dass sie noch was auf dem Herzen hatten. Und richtig, am Tag vor dem Heiligen Abend kam sie: „Du, Vater“, sagte der Große, „dürfen wir euch und die anderen (damit meinten sie meine Frau, mich, die beiden Kleinen und die Lotte, was unsere alte, gute Kinderfrau war) morgen Abend schon halb sieben bescheren?“ „Erst bescheren wir euch, und dann beschert ihr uns!“ meinte der zweite, als wenn es so sein müsste. Nun, ich hatte nichts dagegen, ich war wirklich neugierig, was nun hinter der Heimlichtuerei steckte. Am Heiligen Abend durfte von vier Uhr an niemand mehr in die große Stube. Von meiner Frau hatten sie sich ein Paket Kerzen erbettelt. Sie wollte erst nicht, sie meinte, fünf oder sechs sind auch genug. Da verplapperte sich der kleine Heinrich und sagte: „Da geht sie aber nicht, Mutter!“ Er hatte es kaum raus, da bekam er vom Großen einen tüchtigen Schubs, und der Fritz sagte: Du altes Schaf, wirst es wohl noch verraten!“ Nun, meine Frau war gnädig und gab ein ganzes Päckchen Kerzen her. Aber das Unglück mit dem Kleinsten! Der schrie andauernd, weil er nicht mit in die große Stube durfte. Und richtig, mit seinem Geschrei setzte er seine Kopf durch, meine Frau sagte: „Da nehmt ihn doch mit, damit er sein Maul hält!“ Die Großen wollten erst gar nicht, aber zuletzt blieb ihnen doch nichts anderes übrig, sie mussten ihn mit nehmen. Aber das eine war ausgemacht, bis zur Bescherung sollte der Kleine nicht aus der großen Stube raus, weil er sonst alles verraten würde. Da war meine Frau schnell dabei, denn da war sie den Bläkranzen (Schreihals) für ein paar Stunden los. In der guten Stube war nun mit der Arbeit noch kein Ende abzusehen. Da wurde hin und her gerückt. Endlich kamen sie heraus mit Gesichtern, ich glaube der alte Zeppelin hatte nicht anders ausgesehen, als sein Luftschiff zum ersten Mal richtig ging. Der Kleinste wollte auch mit raus, aber da hielten sie die Türe zu. Erst passte ihm das nicht, dann war er aber mit einem mal ruhig. Wir wurden nun alle zusammengetrommelt. In der kleinen Stube mussten wir antreten, meine Frau, ich, die Lotte mit dem kleinen Mädchen auf dem Arm - auch das Fleischermädchen, das eben gekommen war und seine Schürze zum Heiligen Christ bekommen hatte, musste mit. Dann ging es in einem richtigen Festzug vor in die große Stube. Die Türe ging auf und – vor uns stand eine große, schöne Pyramide. Ich muss sagen, die Jungs hatten wirklich eine feine Arbeit gemacht. . In einem großen Garten, der recht schön mit Moos ausgelegt war, sah man Schafe und Hirten. In der anderen Ecke war ein schönes Schloss, da waren sogar die Fenster aus Seidenpapier, und eine Kerze stand dahinter, es sah wirklich schön aus. Wieder in der anderen Ecke waren ein paar Hirsche, die von einem Baum fraßen, und gleich daneben ein Hund und ein Jäger. Die Hirsche merkten das aber nicht, die fraßen ruhig weiter. Endlich in der vierten Ecke war die Krippe mit der heiligen Maria, dem Josef und dem Christkindlein und natürlich auch all die anderen Männeln, die zu einer richtigen Christgeburt gehören. Die Hauptsache aber war natürlich die Pyramide selber. Vier Etagen hatten die Saugunge (verrückten Jungs) gebaut. Die Säulen hatten sie sich fein drehen lassen, und ringsherum, bei jedem Absatz, war ein Streifen Goldpappe in feinen Bogen geschnitten. Die Scheiben von jeder Etage waren schön grün angestrichen, und auf jeder war etwas anderes zu sehen. Ganz unten war die Jagd. Da liefen Hasen, Hirsche, Rehe, Füchse sowie Jäger mit Hund - alles durcheinander – herum. Ein solches Revier würde sich jeder Jäger wünschen, da käen sie wenigstens auf ihre Pacht. Einen Absatz höher waren die Heiligen Drei Könige mit ihren Kamelen und Eseln und dem Schwarzen zu sehen. In der dritten Etage war ein Schwadron blaue bayerische Reiter auf kleinen Holzpferdchen aufmarschiert. Darüber war ein richtiger Bergaufzug, vom Obersteiger bis zum Huntejungen, alles was dazu gehört. Ganz oben endlich war noch einmal eine Christgeburt, wegen der kleinen Scheibe waren dort die Männeln nicht größer als ein Fingerglied. Und über die ganze Sache waren die Pyramidenflügel gespannt, fein mit himmelblauem Papier und Goldsternlein beklebt. Alles was recht ist, aber so eine schöne Pyramide hatte ich noch nie gesehen. Nur einen Fehler hatte sie, was bei einer Pyramide recht stören kann – sie drehte sich nicht. Sie stand da wie ein Ochs und rührte sich nicht. Meine Jungs machten ganz vernagelte Gesichter, sie taten mir richtig leid. Nur der Kleinste hatte sich in die Nähe der Mutter begeben und war recht kleinlaut. „Na, was ist denn das?“ fing endlich der Fritz an. „Vorhin ging sie doch noch wie der Teufel! Hast du etwa daran gespielt?“ Der Heinrich war aber so verstört: „Ich bin doch gar nicht eher rein gekommen!“ sagte er beleidigt. Ich meinte: „Vielleicht sind die Flügel zu schwer, dass die Wärme nicht reicht!“ „Das kann sein“, sagte der Kleine, „ich hatte es dir oft genug gesagt, du sollst eine dünnere Pappe nehmen! Jetzt haste den Dreck!“ „Was“, sagte der Große, „vorhin ging sie ganz ordentlich. Was du verstehst, das weiß ich auch!“ „Blast mal!“, sagte ich. Die Jungs bliesen, dass ihnen bald die Backen platzten, aber die Pyramide rührte sich nicht von der Stelle. „Habt ihr denn ein Stück Glas unten unter der Welle?“ fragte ich. „Natürlich“, sagten die Jungs. Dann fingen sie an, die Pyramide mit den Fingern an den Flügeln anzustoßen – die Pyramide rührte sich nicht. Da machte sich auf einmal mein Zweiter an den Keinsten ran: „Hast du etwa was daran gemacht?“ Der Kleine fing an zu weinen. Erst wollte er nichts gemacht haben, endlich aber gab er zu, dass er sein Häschen mitfahren lassen wollte. Nun schauten wir noch einmal richtig nach – richtig, unter der untersten Scheibe war der kleine Hase aus Pappmaché eingezwängt, den die Großen aus Schönfeld mitgebracht hatte. Kaum war der Hase raus, drehte sich auch die Pyramide, dass es eine richtige Lust war. Die Kinder tanzten vor lauter Freude in der Stube herum, und ich muss sagen, mir war ordentlich leicht, wie sie so schön lief. Die Jungs hätten mir doch in der Seele leid getan. Nun gings aber los! „Vater, siehst du den Hirsch? Der kosten zwanzig Pfennige im Lewengut.“ „Mutter, dort die Marie kostet fünfzehn Pfennige beim Lahl (Männel-Lahl), aber im roten Kittel, blau kostet sie bloß einen Neugroschen. Siehst du den König dort? Dem ist ein Stück Arm weggebrochen, darum haben wir ihn für drei Neugroschen bekommen, sonst kostet er fünfundsiebzig Pfennige!“ In diesem Text ging es fort, bis endlich meine Frau sagte: „So, nun geht ihr mit der Lotte in die Küche, wir wollen eure Bescherung auch herrichten.“
So sind wir zu einer Pyramide gekommen, und sie wird jedes Jahr bei uns zu Hause los gelassen. Und immer, wenn sie vom Boden runter geholt wird, ist ein großer Drasch (Aufregung), damit nicht etwa wieder ein Häschen drunter gequetscht ist. Und was der kleine Paul ist – er ist inzwischen ein junger Bursche geworden – der wird immer wieder damit aufgezogen.
Wie das Volk spricht...
(Wie´s Volk redt...)
Es hoot e jeder Stand, e jede Gengd, ´s ma sei wu´s will, sei Sprooch vir sich; öb de in de Niederland rümlaafen tust oder ubn bei uns raufhorchst, du hörscht en Haufen Wort, die annere Leit net hobn. Do sei zon Beispiel sette Sprichwörter. Mir hobn nu e paar, die wu annersch net in Schwang sei. Doß´r se net vergaßt, will ich emol paar derzehln...
Es hat ein jeder Stand, eine jede Gegend, es mag sein wo es will, seine eigene Sprache. Ob du im Niederland herum läufst oder oben bei uns darauf hörst, du hörst eine Menge Worte, die andere Leute nicht haben. Da sind zum Beispiel solche Sprichwörter. Wir haben nun ein paar, die wo anders nicht bekannt sind. Damit ihr sie nicht vergesst, will ich einmal paar erzählen.
Da war in der Waschleithe (Ort) einmal einer, der war nicht arm und nicht reich, er war, wie man so spricht, ein Mittelmann. Er hielt aber auch die Pfennige nicht so fest in der Tasche; wenn er Geld hatte, ließ er auch etwas drauf gehen. Es gab Leute genug die sagten, wenn er etwas mehr auf den Pfennig sehen würde, könnte er es auch zu etwas bringen. Aber er ließ die Leute reden; nur wenn es ihm mal zu dumm wurde, dann sagte er: „Geht mir nur weg! Was man spart an Mund, das kommt nur vor die Hund!“ (Gieht mer när wag! Wos mer spart an Mund, dos kimmt när für de Hund!“)
Während der Ernte, da haben die Bauern Arbeit, das kann man nicht anders sagen. Wenn nun in Crutendorf (Crottendorf) der Hans-Jörg-Christ vom Feld rein kam, da hatte er nur zu tun, dass die Pferde in den Stall kamen und ihr Futter bekamen. Aber dann schickte er schon nach seiner Frau, ob das Essen schon fertig sei. Die hatte nun manches Mal auch etwas anderes zu tun, aber dem Christ seinem Appetit nach ging es nicht schnell genug. Wenn es nun doch zu lange dauerte, da war es mit seiner Geduld zu Ende und er schrie zur Haustüre rein: „Nun beeilt euch aber! Schafft das Essen her! Mich hungert weiß Gott so sehr, dass man es hier draußen hört!“ („Nu mahrt eich oder aus! Schafft´s Assen har! Mich hungert, weß Gott, esu, doß mer´sch haußen hört!“)
Mit dem Essen, das ist überhaupt so eine Sache. Da gibt es wirklich welche, die nicht wissen, wenn sei genug haben. Dem Pfeifer-Franz in der Wies (Ort: Wiesa) schmeckte es jeden Tag. Er war auch nicht etwa wählerisch, was da war, das schmeckte ihm. Nur genug musste es sein, damit er satt wurde. Am meisten Hunger hatte er, wenn es Ardäppelkließ (Kartoffelklöße) gab. Wenn er so an die vierzehn Stück verdrückt hatte so groß wie die Kaffeetassen, da war er richtig traurig darüber, dass er keinen Platz mehr im Bauch hatte, und sagte: „Ach wenn der Buckel nur auch noch so einen Magen hätte!“ Und manches Mal, wenn er so ordentlich voll gefüllt war, dass nichts mehr rein ging, sagte er: „Na, nun habe ich mir mal wieder einen Halm durch das Maul gezogen!“
Wenn der Roscher-Karl in Hohndorf Kindtaaf (Taufe) hatte, und das war jedes Jahr mindesten ein Mal, da wurde aller Donner und Teufel eingeladen. Ging es aber dann zu Tisch, da sagte er: „Na, dann esst und trinkt, ihr Gevattern, und ihr Geistlichen nehmt nicht zu viel Butter!“ Sah er jemanden, der wirklich nicht mehr konnte, bei dem das Sauerkraut und der Schweinebraten bis oben stand, da redete er ihm gut zu und sagte: „Immer esst nur, ihr könnt euch gar nicht vorstellen, wie viel in einen Menschen rein passt!“ (Immer aßt när, ihr könnt eich gar net virstelln, wieviel in en Menschen neigiht!“)
Da hatten sie in einem Ort einen neuen Gendarm (Polizisten) bekommen. Das war wirklich kein guter Mann. Man dachte, er wäre vom Teufel für den Ort eingesetzt worden. Wo er nur konnte, versuchte er den Leuten eins auszuwischen. In der heutigen Zeit würden sie so einen Dingerich (komischer Kerl) gewiss nicht zum Gendarm machen. Die Leute gingen ihm auch aus dem Weg, wo sie nur konnten. Da fragte der Seifert-Emil einmal den Schwamme-Seph (Joseph): „Nu, Seph, was denkst du denn über den neuen Gendarm?“ „Nu“, sagte der Seph und zog die Augenbrauen hoch, „das ist einer aus der siebenten Bitte!“
Die Schwob-Liesel war nun schon achtzehn Jahre und hatte noch keinen Kerl. Da wurde ihr langsam Angst; noch aber ihrer Mutter. Wie sie nun einmal zur alten Potmuhme (alte Tante) kam, da hat sie geklagt, dass sie für die Liesel noch nichts gefunden hätte. Da sagte die Alte: „Ach, altes Gelapp (Gequatsche)! Darum mache dir keine Sorgen. Schon immer bekam jede Birne ihren Stiel, und jeder Topf seinen Deckel!“ (Ach, altes Gelapp! Dodrüm mach dr käne Sorng! Meitog kriegt jede Berr ihrn Stiel un jeds Tippl sei Sterz!“)
Nun will ich aber aufhören! Ihr werdet schon gemerkt haben haben: Unsere Leute haben nicht nur das Herz, nein auch das Maul auf dem richtigen Fleck. Grob aber fein – wir sind, wir wir sind! (Grob oder fei – mer sei, wie mer sei!)
* * *
Emil Müller
Emil Müller wurde am 27. Mai 1863 in Annaberg geboren. Die Eltern waren Posamentenarbeiter. Nachdem er die Schule und das Lehrerseminar in Annaberg abgeschlossen hatte, bekam er zunächst eine Stelle als Lehrer in Ehrenfriedersdorf, dann in Schönfeld bei Leipzig. 1887 war er bereits in Dresden wo er ab 1889 als Oberlehrer und ein Jahr später – bis zu seiner Pensionierung im Jahre 1932 – als Schulleiter tätig war.
Er starb am 20. November 1940 in Dresden. Emil Müller befasste sich mit volks- und heimatkundlichen Themen und hat uns zahlreiche Gedichte, Erzählungen sowie ein Theaterstück in erzgebirgischer Mundart hinterlassen. Darunter sein anrührendes Wiegenlied (1909) oder die nachfolgende Geschichte aus dem Jahre 1908:
Du weißt nicht, was du willst
(Du weßt net, wos de willst)
„Na, du altes Sauluder, trifft man dich auch mal wieder? Was machst Du denn so, ist das Leben noch frisch?
„Nun, wie du siehst, das Sterben heben wir bis zuletzt auf.“
„Du, was ich dir sagen wollte, möchtest du denn mal mit nach Olbernhau? Da ist jetzt eine große Ausstellung, die soll großartig sein! Feuerspritzen und allerhand Maschinen und neue Seife und neuer Schnaps und lauter solches Zeug, das soll wirklich sehenswert sein zum anschauen.“
„Ha, das ist ja alles recht gut und schön, aber weißt du, das sind doch ziemlich drei Stunden zu laufen. Das ist mir zu weit. Das schaffe ich nicht. Da sehe ich lieber davon ab.“
„Nun, nein, drei Stunden, die hat der Fuchs gemessen. Das sind ziemlich acht Stunden.“
„Acht Stunden? Du bist ja nicht gescheit! Nein, weißt du, fünf, auch sechs wäre ich gelaufen, aber acht, das kann ich mir nicht zumuten.“
„Nun, wir fahren ein Stück, da ist es dann nicht so schlimm.“
„Fahren? Um Gotteswillen nicht! Das ist nicht mein Fall! Wenn wir bis hin laufen würden, dann würde ich eventuell mit machen. Da ließe ich mich noch beschwatzen, aber fahren, nein, das tut mir leid, da rechne nicht auf mich!“
„Nun, da laufen wir meinetwegen, mir ist es egal.“
„Jetzt willst du wieder laufen, du weißt nicht, was du willst!“
* * *
Hermann Lötsch
Der einst in Geyer und Gelenau tätige Hilfslehrer Hermann Lötsch wurde am 18. August 1880 in Annaberg geboren. Ab 1904 studierte er für zwei Jahre in Grenoble und Paris. Kam nach Annaberg zurück und erhielt zunächst hier eine Anstellung als Lehrer und später dann in Altenberg, Oelsnitz und Eibenstock. Er studierte Wirtschaft in England und noch einmal in Frankreich, um um 1920 als diplomierter Handelslehrer in Mainz und danach als Studienrat in Lübeck zu unterrichten. Es ist nur bekannt, dass er 1934 in den Ruhestand trat. Vermutlich ist er Anfang der 40er Jahre in Norddeutschland gestorben. Die Verbindung zum Erzgebirge brach nie ab. Seit 1905 schrieb er Lieder, Gedichte und Erzählungen in erzgebirgischer Mundart. Die hier veröffentlichte Humoreske entstand 1908:
Der Wettlauf
(Dr Wettlaaf)
Früher waren die Schutzleit (Schutzleute, Polizisten) nicht so ausgerüstet wie jetzt. Sie hatten nur eine Mütze auf, ungefähr wie die böhmischen Soldaten, einen Dienstrock und einen Knotenstock in der Hand. Weil sie keinen Säbel hatten, brauchten sie auch kein Säbelkoppel, und dem Dickwerden stellte sich also kein Hindernis entgegen. So kam es vor, dass manche Schutzleute ganz schön dick waren. Das passierte auch dem Wachtmeister Krauße. Der war früher Posamentierer, weil er aber nicht all zu verrückt nach Arbeit war, hatte er sich auf eine Polizeistelle in Annaberg beworben und wurde genommen. Er war recht auf dem Damm und bewahrte die Stadt vor so manchen Unheil. Wenn etwa die Landstreicher um das Rathaus herum betteln wollten, dann steckte er die unbarmherzig ins Loch.
Da ist einmal mit so einem Fachtbruder (Bettler), eine drollige Geschichte passiert. Der Bettler hatte schon bald die ganze Kartengasse abgeklappert und wollte nun auch noch dem Bäcker Hackel sein Haus mitnehmen. Da bog der Krauße – er hieß jetzt „Herr Wachtmeister“ - um die Ecke an der Wolkensteiner Straße. Als er den Bettelmann sah, schrie er gewichtig: „Sie sind arretiert!“ Der schaute sich erschrocken um, und als er den dicken Krauße sah, lachte er nur und verschwand im Bäckerhaus. Der Polizist triumphierte; der Braten konnte ihm nicht entgehen. Es dauerte ein paar Minuten, da hörte man drinnen etwas die Treppe runter klappern. Der Schutzmann stellte sich dicht vor der Haustüre in die Niesche, damit man ihn nicht sehen sollte. Aber der Landstreicher war auch nicht auf den Kopf gefallen. Er schielte vorsichtig von der Treppe aus um die Ecke herum. Da sah er die Rundung vom Bauch des Wachtmeisters hervor schauen. Er stieg nun ganz runter, setzte an und – schwups war er draußen. Dabei hat der Krauße auch noch einen kräftigen Stoß abbekommen. Er krächzte, aber was half es, er musste dem Taugenichts nach rennen. Nun ging es im Galopp um die Ecke an der Wolkensteiner Straße dem Tor zu. Der Wachtmeister kam nicht recht vorwärts, aber der Bettelmann war ein gutmütiger Kerl. Als er sah, dass sein Verfolger zurück blieb, hielt er von Zeit zu Zeit an, bis er wieder ein bisschen näher war. An der Bräuer-Ecke stand der Bettelmann wieder still. Schweißtriefend kam das dicke „Auge des Gesetzes“ angehetzt. Schon wollte er ihn fassen, aber mit einem Sprung war er wieder weit davon. Und der Wachtmeister giebset (keuchte) hinterher. Dort, wo jetzt das Denkmal ist, stand damals eine kleine Bank. Da setzte sich der Taugenichts am äußersten Ende nieder. Der Krauße kam nach einer Weile angekeucht und setzte sich schüchtern – der Bettelmann könnte vielleicht gleich wieder abrücken – an das andere Ende. Beide verschnauften. Der Dicke schnappte nach Luft. Als sie nun ein paar Augenblicke so da gesessen hatten, erhob sich der Landstreicher langsam von seinem Sitz und sagte zum Wachtmeister, der sich gerade mit dem Rockärmel den Schweiß von Stirn und Nase wischte: „Na, wollen wir wieder?“
* * *
Albert Schädlich
Albert Schädlich ist zwar von Geburt Vogtländer (geboren am 11. Juli 1883 in Elsterberg), aber seit seinem 19. Lebensjahr – bis zu seinem Tot am 23. Juni 1933 - wohnte er im erzgebirgischen Lauter. Schädlich lernte Werkzeugmacher und war viele Jahre im Emaillierwerk tätig, in den letzten Jahren vor seiner Rente als Meister. Bekannt ist er mit seinem Rufnamen „Der Lauterer Gevatter“ geworden, als der er auch in Veranstaltungen auftrat und seine Lieder, Gedichte und Humoresken vor trug. Bei den hier veröffentlichten handelt es sich um Texte zwischen 1909 und 1929. Die Schnurre „Stöckraustu“ (1928) erzählt in ähnlicher Weise auch Hans Soph aus dem böhmischen Erzgebirge. Vielleicht ein interessanter Vergleich:

Stöckraustu
(Wurzeln/Stöcke von abgesägten Bäumen ausgraben)
Der Kunstma Lob (Leopold Kunstmann) fuhr eines sonntags in der Früh raus in den Wald zum Stöcke ausgraben. Kurz vor dem Holzschlag stand ein schönes Bäumchen gleich neben der Straße. „Ob ich den abschneide oder einen anderen“, dachte er, „das ist egal.“ Die Säge raus und los ging es. Gerade in dem Augenblick als das Bäumchen oben rüber kam, kam auch der Förster. „Was soll denn das sein?“, fragte er den Lob. „Was soll´s denn weiter sein, ich grabe Stöcke aus!“ „Na, siehst du Schafskopf denn gar nicht, dass an dem Stock noch ein Baum daran hängt?“ schrie der Förster den Lob an. Der ließ sich aber nicht aus der Ruhe bringen und meinte: „Wenn ich Stöcke ausgrabe, muss ich unten aufpassen, da schau ich doch nicht in die Höh´!“
Der Lumpenmann
(Dr Lumpenma)
Drüben in der Muhme (das ist der Ehrentitel für Lößnitz) wohnte vor Jahren ein Lumpenhändler. Der hat ganz klein angefangen. Der verstand sein Fach und brachte es mit der Zeit auf ein zweispanniges Hundegeschirr, er hat später sein Geschäft auch groß betrieben. Auch in Schneeberg hatte er mitunter zu tun. Da fuhr er über das Brünlaßgut an Oberschlema vorbei. Vom Brünlaßgut geht es ganz schön bergab, und da hat sich der Lumpenmann natürlich auf seinen Wagen drauf gesetzt. Das ist aber doch polizeilich verboten, jeder Straßenwärter kann einen da anzeigen, wenn man erwischt wird.
Einmal hatte er sich wieder auf seinen Wagen drauf gesetzt und die Hunde liefen, was das Zeug hält. Wo der Wald zu Ende ist, macht die Straße einen plötzlichen Bogen. Und wie er so durch die Kurve saust, stand, wie aus der Erde gewachsen, auf einmal mitten auf der Straße der Gendarm. „Halten Sie auf“, brüllt der und machte Arme und Beine breit. „Halten Sie auf!“ Der Lumpenmann war aber so gottjämmerlich im Schwung und rief nur: „Heute habe ich keine Zeit, heute kann ich niemanden mitnehmen!“
Der letzte Pfannkuchen
(Dr letzte Pfannkuchn)
Da kam einmal ein Reisender etwas spät nach Mittag in einen Gasthof und wollte ein warmes Essen. Er hatte aber kein Glück. Die Wirtsleute waren gerade einmal weg gefahren, und die Großmutter Ernestine war mit ihrem Alter nicht mehr so auf Trapp.
Sie wolle dem Herrn Reisenden aber gerne einen Kaffee machen, wenn er eventuell darauf Appetit hätte. „Gut, bringen Sie mir eine Tasse Kaffee! Vielleicht haben Sie etwas Gebäck dazu?“ sagte der Mann. „Gebäck? Nee, da haben wir nichts im Haus. Aber wenn Sie mal zum Bäcker Hähnel hinüber gehen wollen, der hat heute frische Pfannkuchen; ist gleich über die Straße.“ Dem Mann blieb nun nichts anderes übrig, er ging raus vor die Türe und sah da gerade einen kleinen Jungen. „Ach, Kleiner, willst du für mich einmal zum Bäcker hinüber gehen? Holst drei Pfannkuchen, einer davon gehört dir, da hast du fünfzehn Pfennige!“ Der Junge sauste hinüber. Nicht lange danach kam er wieder und würgte einen Pfannkuchen in seinen Mund und sagte: „Da haben Sie Ihren Neugroschen wieder, sie hatten bloß noch einen!“
* * *
Hans Soph
Hans Soph (* 19. Januar 1869 in Platten; † 29. Januar 1954 in Zwickau) war ein Komponist, Mundartdichter und kunstgewerblicher Maler. Sophs erste drei Lieder in der Mundart des Erzgebirges entstanden 1886. 1890 ging er als Handwerksbursche auf Wanderschaft und ließ sich in Thüringen nieder. Von dort kehrte er 1894 in seine erzgebirgische Heimat zurück, zuvor hatte er - wie Anton Günther einige seiner Lieder bereits auf Postkarten drucken lassen. Er wirkte in Eibenstock, Aue und seit 1902 bis zu seinem Tod in Zwickau. Von seinen Mundart-Erzählungen existieren nur wenige in Schriftform. Er sprach sie frei aus dem Gedächtnis bei seinen Veranstaltungen oder in Rundfunksendungen, die aber auch nicht alle aufgezeichnet wurden. Die folgenden wurden in Heimatblättern veröffentlicht und können so hier in das Hochdeutsche übertragen werden. 
Wovon stammt der Mensch ab!
(Wu stammt der Mensch oh!)
Der Schusterfranz-Karl war ein ordentlicher und fleißiger Mann. Er hat auf seine Frau und seine Kinder gehalten, hatte ein schönes Häuschen und neben seinem Handwerk ein bisschen Landwirtschaft. Er war auch nicht auf den Kopf gefallen, konnte gut reden und war deshalb auch im Gemeinderat. Kurz und gut: Ein Mann, wie er im Buche steht! Aber wie halt nichts auf der Welt ohne Fehler ist, so war es auch mit dem Karl, der hatte auch seine Fehler. Er hatte nämlich eine große Ähnlichkeit mit einem Affen. Nicht nur sein Gesicht, sondern auch das ganze Gestellwerich (die ganze Gestalt) und seine affenartige Geschwindigkeit haben dazu beigetragen.
Das hat dem Karl manchmal viel Ärger und Spott eingetragen, aber weil er so eine gute Gusch (Mund) hatte, kam es immer so weit, dass die, die ihn foppen wollten, selber die Gefoppten waren.
Einmal musste er fort, und weil der Bahnhof etwas weit weg war, kam der Karl etwas verspätet dort an. Es war, wie man so sagt, die höchste Eisenbahn! Der Schaffner, der den Karl gut kannte, hat ihn gleich in den Wagen rein gestopft und der Zug fuhr los. Der Karl, der in den Wagen mehr rein gekugelt als gestiegen ist, wollte eigentlich in der zweimal zweiten Klasse (eigentlich 3. Klasse) fahren, ist aber in die einmal zweite hinein geraten. „Na, ist auch egal, mehr bezahle ich auch nicht“, dachte er bei sich und machte es sich gemütlich.
Da drinnen saßen nun zwei recht lackierte Bossen (Jünglinge), nicht zu alt, aber nach Karls Ansicht war das nichts Gescheites. Die Kerle hatten kaum den Mann gesehen, da führten sie miteinander ein Gespräch: Der Mann würde vom Affen abstammen... Aha, denkt der Karl, jetzt heißt es aufpassen, die Ohren spitzen und die Zunge quer ins Maul nehmen. Er beachte sie gar nicht, zündet seine Pfeife an, stützt sich auf seinen Spazierstock und schaut zum Fenster raus.
Die Kerle wurden aber immer heftiger, so dass es dem Karl Angst und Bange wurde von dem gelehrten Gelatsch (Gequatsche, Gerede). Es hat ihm förmlich die Haare zu Berge gezogen, wenn er nicht seine feste Mütze aufgehabt hätte. Endlich hat doch einen von den beiden Kerlen der Hafer gestochen und er sagte zum Karl: „Nun, lieber Mann, was sagen Sie zu unserer Unterhaltung, sind Sie nicht auch der Meinung, dass der Mensch vom Affen abstammt?“
Da steht der Karl auf, stellt sich n seiner ganzen Größe vor die Zwei hin, nimmt Pfeife aus dem Maul und sagt: „Hört mal zu ihr Bossen! Ich bin zwar nicht so studiert wir ihr, bin nur in die Dorfschule gegangen, aber wo ich abstamme, das weiß ich ganz genau. Denn meine Eltern, Groß- und sogar Urgroßeltern, die ich noch gekannt habe, das waren alles schön gewachsene Menschen, genau so wie ich. Wenn ich aber euch Zwei anschaue – mit den langen Armen, den rundum abgeschnittenen Haaren um den Ohren und die großen Glotz-Brillen auf den Nasen, da wird es bei euch schon stimmen, dass ihr von den Affen abstammt. Denn eure bucklige Verwandtschaft habe ich gar nicht gekannt. Euch rechne ich aber zu den Brillenaffen!“
Der Zug hielt, der Karl steigt aus und lässt die gelehrten Bossen weiter darüber nachdenken, von wo sie abstammen.
Die schmutzigen Füße
(De drackiten Pfuten)
Als Kinder sind wir meistens barfüßig gegangen. Wenn es dann geregnet hat und recht matschig draußen war, da hat man gewöhnlich recht dreckige Pfuten (Füße/Hände) gehabt. Unsere alten Leute hatten andauernd damit zu tun, das wir uns ja nicht mit solchen Füßen abends ins Bett legen. Als ich in die Schule ging, hat mal unser Lehrer eingeführt, dass, bevor wir ein Gedicht aufsagen mussten, eine Verbeugung machen sollten, und zwar so, dass wir den einen Fuß an den anderen heranziehen sollten, danach das Gedicht vortragen, und wenn man fertig ist, noch mal das gleiche. Aber trotzt aller Mühe von unserem Oberlehrer konnte es keiner richtig machen. Nur ich habs nach seinem Willen fertig gebracht und habe mir viel darauf eingebildet. Einmal schickte der Lehrer aus der dritten Klasse runter, ich sollte mal hoch kommen. Das war doch was ganz Seltenes, und unser Oberlehrer sagte mir beim Hinausgehen: „Nun, was wirst du Dingerich“, so sagte er immer zu uns Lausejungen, „denn wieder einmal ausgefressen haben!“ - Denn an losen Streichen hat es bei mir nicht gefehlt, und die Treppe hoch hat mir das Herz ein wenig geklopft.
Als ich oben in die dritte Klasse rein kam, war der Lehrer recht freundlich und hat zu mir gesagt: „Beim letzten Schulausflug hast du ein Gedicht vorgetragen und dabei vor- und nachher eine schöne Verbeugung gemacht. Mache es meinen Schülern einmal vor, ich will es bei mir auch einführen.“ Da bin ich, stolz wie ein Spanier, auf die Bank rauf, die vor der großen Tafel stand, hab meine Füße zusammen geschlagen, eine großartige Verbeugung gemacht und das Gedicht: „Kaiser Josef und der Reiter Johann Stauff“ mit lauter Stimme vorgetragen. Danach hab ich eine noch viel größere Verbeugung gemacht und bin von der Bank runter gesprungen. Da sagte der Lehrer zu den Kindern: „Habt ihr also gesehen, wie man vor und nach dem Gedicht eine Verbeugung macht? Merkts euch, so müsst ihr es in Zukunft auch machen!“ Ich stand da, als wenn ich ein Wunderwerk vollbracht hätte und war mächtig stolz auf mich selbst. Der Lehrer sagte zu mir: „Du kannst gehen.“ - er ging mit hinaus und sagte richtiger erzgebirgischer Sprache zu mir: „Dei Zeig host de ganz gut gemacht, ober host de dä aah deine drackiten Pfutn ahgesaah, wie de die Verbeigung gemacht host? Schaamst dich de dich dä net, miet sette Pfutn in der Schul ze kumme?“ (Dein Zeug hast du ganz gut gemacht, aber hast du denn auch deine dreckigen Füße angesehen, wie du die Verbeugung gemacht hast? Schämst du dich denn nicht, mit solchen Füßen in die Schule zu kommen?) - und hochdeutsch sagte er noch: „Dass mir das nicht wieder vorkommt!“ Da war ich aus allen Himmeln gefallen, und dass ich mich mächtig geschämt habe, könnt hr mir glauben, das hätte mir der Lehrer nicht sagen müssen.
Die Fanni
(De Fanni)
Sie war das schönste Mädchen im Ort und das will schon viel heißen, denn es gab noch mehr, die schön waren. Aber an die Fanni konnte halt in dieser Beziehung keiner ran reichen. Sie war schlank gewachsen wie eine Tanne, hat braune fast schwarze Haare, blaue Augen, rote Backen und einen Mund voll schöner weißer Zähne. Aber das Schönst war ihre Freundlichkeit und ihr gutes Gemüt. Sie hat für alle, ob hoch oder niedrig, ein gutes und richtiges Wort, und jedweder war ihr gut. Nun, eben so ein richtiges erzgebirgisches Kind. Sie hatte aber auch ihren Stolz und konnte kein Unrecht erleiden.
Kam sie aber einmal am Sonntag ins Wirtshaus, da war Leben in der Bude. Die Fanni hat gesungen und Gitarre gespielt, dass es eine Freude war, und die Alten haben das Kartenspiel eingestellt und zugehört. Wenn alles recht aufgelegt war und es wurden Tschumperlieder (lustige Lieder) gesungen, da war die Fanni in ihrem Element, und keiner konnte es mit ihr aufnehmen. Sie hat mit ihren Einfällen „aus der Tasch“ (aus dem Stegreif) einen jeden niedergesetzt und hatte die Lacher auf ihrer Seite.
Als sie noch klein war, gab es mal einen recht langen Winter. Das Frühjahr kam spät und das Heu war alle, und die zwei Kühe und die Ziege, die im Stall standen, hatten bald nichts mehr zum Fressen. Da ging die Mutter öfters in den Wald und hat einen Korb voll Waldgras geholt, denn der Hunger quält auch Kühe und Ziegen. Aber einmal hat sie doch der Forstadjunk erwischt, den Gras holen aus dem Wald war verboten. Er hat das Gras ausgeschüttet und der armen Frau, trotz Bitten und Betteln, den Korb weg genommen und ihren Namen aufgeschrieben. Ein paar Tage später kam ein Zettel, die Mutter soll aufs Forstamt kommen. Ach du großes Unglück! „Was wird denn dann über uns herein brechen?“, so hat sie gejammert und die Kinder mit. Am meisten aber hat die Fanni geweint: „Ach Gott, Mutter, die werden dich doch nicht einsperren!“
Als nun die Mutter ins Forstamt kam, da saß im Vorzimmer der Adjunk. Im Nebenzimmer der Oberförster. „Wer ist da?“ fragte er. Da sagte der Adjunk: „Die Diebin ist da, die ich letzthin beim Walddiebstahl ertappt habe!“ „Soll herein kommen!“, schallte es aus dem Zimmer. Die arme Frau wusste vor Zittern nicht, wie sie in dies Stube hinein gekommen ist. Ach du lieber Gott, dachte sie, eine Diebin soll ich sein! In ihrem ganzen Leben hat sie keinen Menschen je um einen Zwirnsfaden bestohlen. Der Oberförster war aber ein vernünftiger Mann, er hat ihr zu verstehen gegeben, dass das Waldgrasholen verboten ist, und sie soll es nicht mehr machen. Ihren Korb kann sie auch wieder mitnehmen.
Als sie aber nach Hause kam, da konnte sei sich nicht mehr halten, ist auf den Stuhl hin gesunken und hat bitterlich geweint. Alle waren betroffen, nur der Vater hat sie ruhig angesprochen und gefragt, was denn eigentlich los ist. - „Eine Diebin soll ich sein!“ presst die arme, verängstigte Mutter raus und weint und jammert wieder. „Wegen eines Korbes Waldgrases brauchst du dir keine Gewissensbisse zu machen. Draußen im Wald verfaulen jährlich Tausende von Zentnern. Es ist halt so ein Gesetz, aber vor dem lieben Gott ist das kein Diebstahl.“ Es hat sich nach und nach alles beruhigt. Nur der Fanni wollte dieses Unrecht nicht aus dem Kopf gehen, und den grasgrünen Adjunkt konnte sie von dieser Stunde an nicht mehr riechen.
Ein paar Jahre waren über diese Geschichte hinweg gegangen. Der Forstadjunkt war mittlerweile Förster geworden, hat in der Nähe vom Städtchen sein Revier und Forsthaus. Er war auch verheiratet, aber seine Frau starb bald und hatte zwei Kinder hinterlassen. Er selbst kam selten in die Stadt. Einmal ging die Fanni über die Gasse, da kamen zwei schön angeputzte Mädchen auf sie zugesprungen. Die Fanni, die ein großer Kinderfreund war, hat gleich das kleine Mädchen auf den Arm und den Jungen an die Hand genommen und abgedrückt. Die Kinder waren so zutraulich, als wenn sie die Fanni schon lange kennen würden. Das Mädchen hat sogar ihr Ärmchen um ihren Hals gelegt und der kleine Junge hat sich gefreut und gelacht.
Auf einmal stand der Förster, wie aus der Erde gewachsen da. - Die Fanni, den Mann gesehen, die Kinder aus der Hand gegeben und Ausreiß genommen waren eins, denn es waren die Kinder des Försters. Der Förster, der als junger Adjunk ihre Mutter eine Diebin geheißen hatte. Der rief zwar der Fanni etwas nach, die sah sich aber nicht um und war im Nu auf und davon. Sie wusste nicht, dass es die Kinder vom Förster waren.
Einmal war die Fanni im Wald um einen Korb Holz zu holen, wie es so im Erzgebirge ist, wo die Leute Klaubholz (zusammengesuchtes Kleinholz) auf dem Rücken nach Hause tragen. Wie sie nun an dem heißen Sommertag mit ihrem schweren Korb ein wenig am Weg auf einem Stein ausruhen und sich jetzt den Schweiß von ihrem hitzigen Gesicht abtrocknen wollte, kommt aus dem Gebüsch raus – der Förster.
Die Fanni war so erschrocken, dass sie über und über gezittert hat. Sie wollte auf und davon, konnte aber nicht aufstehen, so sehr war ihr der Schreck in die Glieder gefahren. Der Förster blieb stehen und sagte: „Aber Fräulein Fanni! Warum erschrecken Sie denn so, ich tue ihnen doch nichts. Im Gegenteil, es ist mir sehr angenehm, einmal mit Ihnen zu sprechen!“ „Sie wollen mich wohl gar aufschreiben und anzeigen wegen des bisschen Holzes, das ich da in meinem Korb habe?“ sagte die Fanni. „Keine Spur, Klaubholz ist doch frei.“
Nun, dann wüsste ich nicht, was Sie mir zu sagen hätten. Ich muss nach Hause und mein Korb ist schwer.“ „Es tut mir leid, wenn ich sehen muss, wie Sie sich mit dem Holzholen abmühen müssen, denn wenn Sie nur wollten, brauchten Sie das nicht mehr zu tun.“
„Wie soll ich denn das machen?“, fragte die Fanni spitz. „Ich bin armer Leute Kind und muss arbeiten. Ich plage mich auch gerne, dafür kann ich doch, wenn ich will und Zeit habe, immer in meinen schönen grünen Wald gehen.“
„Nun“, sagt der Förster, „wenn das Ihr Ernst ist, Fräulein Fanni, so wäre sogar leicht möglich, dass Sie immer im Wald wohnen könnten!“
„Da bin ich aber neugierig, was da rau kommen wird“ spöttelte die Fanni. „Nun ganz einfach, Fanni, werden Sie meine Frau!“ - „Was für Zeug?“ fährt die Fanni jetzt hoch. „Meine liebe Frau!“ wiederholt er. „Ich habe Sie beobachtet, wie liebevoll Sie zu meinen Kindern waren und da dachte ich und brachte den Gedanken nicht mehr los, nur Sie, liebe Fanni, könnten meinen Kindern eine zweite Mutter sein!“ Darauf sagte die Fanni: „Nee, Herr Förster, das kann nicht zusammen passen.“ „Warum denn nicht?“ fragte der Förster. Da schreit die Fanni wie ein wundes Reh und die Tränen standen ihr in den Augen: „Weil meine Mutter eine Diebin ist!“ „Was“, sagte der Förster, „das ist doch gar nicht möglich, die Mutter einer so ehrbaren Familie? - unglaublich!“
„Es ist aber nicht anders, denn Sie selbst haben meine Mutter zu einer Diebin gemacht!“ „Aber Fanni, ich weiß gar nicht, was ich von Ihnen denken soll.“ „Das werde ich Ihnen gleich sagen“, meint die Fanni. „Wissen Sie noch, als Sie als Adjunkt meine Mutter wegen eines Korbs Waldgras angezeigt haben und wie Sie sie vor dem Oberförster eine Dibin genannt hatten?“ „Aber Fanni, das ist doch lange her, und das Gesetz schreib es damals vor. Ich habe ja nur im Dienst gehandelt. Vergessen Sie das und erfüllen Sie meinen einzigen Wunsch, werden Sie meine Frau und die Mutter meiner Kinder. Sie aollen alles haben, was in meinen Kräften steht, und vor allen Dingen ihren geliebten Wald!“
Da schreit die Fanni: „Und wenn Sie gleich Oberförster wären und mir den ganzen Wald schenken würden, Sie mag ich nicht, denn ich kann es nicht vergessen, was Sie damals für ein Herzeleid in unser Haus gebracht haben!“
Sie ab sich einen Ruck, machte sich mit ihrem Korb auf die Beine und ließ den verblüfften Förster stehen. -
Die Geschichte ist wirklich wahr, und die Fanni lebt heute noch, und wenn sie gut gelaunt ist, singt sie und spielt die Gitarre dazu. Sie ist so geblieben im Ort, dass sie nur die „Mahm-Fanni (Muhme/Tante-Fanni) genannt wird.
* * *
Arthur Günther
Der am 1. Dezember 1885 in Schneeberg geborene Sohn eines Handwerkmeisters ist vermutlich nicht mit dem „Sänger des Erzgebirges“ Anton Günther verwandt. Aber auch er schrieb zahlreiche Gedichte, Erzählungen und Theaterstücke in erzgebirgischer Mundart und in Hochdeutsch sowie volkskundliche Abhandlungen. Nach dem Besuch der Schneeberger Volksschule erlernte er in Zwickau den Kaufmannsberuf. Später war er als Angestellter der Stadt im Verwaltungsdienst und als Leiter des Verkehrsamtes tätig. Er war auch Kirchenvorstand, Schöffe und Stadtverordneter. Arthur Günther war Freimaurer und vielleicht auch deshalb kein Mitglied der NSDAP. Er organisierte allerdings als Geschäftsführer die auch propagandistisch genutzte „Schneeberger Weihnachtsschau“ 1938/39, die weit über die Grenzen Sachsens hinaus bekannte und von mehr als 70.000 Menschen besucht wurde. 1945 tritt er in die Liberaldemokratische Partei Deutschlands (LPD, später LDPD) ein und übernimmt die Leitung des Kulturamtes in Schneeberg. 1948 ist er der Gründer des hiesigen Kulturbundes. Zu seinem 80. Geburtstag verlieh ihm seine Heimatstadt die Ehrenbürgerschaft. Am 8. März 1974 starb Arthur Günther in Schneeberg. Den folgende Text schrieb er 1937:
Helmut Ziehnerts Weihnachtsberg
(Ne Ziehnert-Helm sei Weihnachtsbarg)
Der Ziehnert-Helm baute an seinem Weihnachtsberg. Früher war das nur ein Weihnachtsgärtchen, aber so nach und nach wurde ein richtiger Weihnachtsberg daraus, der die halbe Stube einnahm. Der Helm hatte eine besondere Leidenschaft. Jedes Jahr musste sein Berg ein wenig verändert werden. Alles Neue musste mit hinauf, aber das Alte wurde nicht weggetan. Dadurch hatte der Weihnachtsberg ein ziemlich bunt geschecktes Bild bekommen. Wenn seine Enkel um die alten Figuren bettelten, sagte er: „Verlangt was ihr wollt, aber von meinen Figuren kann ich keine weg geben.“
Bunt genug sah der Weihnachtsberg aus. Man wusste gar nicht, was man zuerst anschauen sollte. Adam und Eva unterm Apfelbaum, die ersten Bewohner vom alten Weihnachtsgärtchen hatten sich ganz hinten in eine finstere Ecke verzogen. Ganz unten, wo zuerst nur Schäfchen und Hirten gestanden hatten, da war das Bild bedeutend verändert. Auf der breiten beweglichen Straße, auf der früher die drei Weisen aus dem Morgenland hergezogen kamen, da flitzen jetzt die Autos, Wagen und sogar eine Feuerspritze vorbei. Dazwischen quirlte noch ein Haufen Volk herum. An der Straße stand ein Polizist, der heftig winkte. Seitwärts in der Straße waren die Hirten mit ihren Schafen und eine Jagd mit Förster, Hirsche, Rehe und anderes Viehzeug machte sich da breit. Ein wenig höher, auf den Berg rauf, kam eine kleine Eisenbahn gerattert, die sauste aus einem Tunnel über eine Brücke rein in einen anderen Tunnel. Das war Helms Sorgenkind, denn die kleine Bahn entgleiste öfters mal. Die Kurve war eben ein wenig zu eng. Rechts von der Eisenbahn zog sich die heilige Stadt Jerusalem hinauf. Gleich am Anfang stand der Palast des Herodes, vor dem sich ein Haufen Kriegsknechte versammelt hatten. Und daneben im Gestrüpp sah man die Weihnachtskrippe mit der Heiligen Familie. Auf der linken Seite vom Berg zog sich ein kleines Erzgebirgsdorf in die Höhe mit kleinen Häuschen, in denen Licht brannte. In einem alten Wurzelstock sah man Bergleute bei der Arbeit. Zwischen den Häuschen marschierte ein Bergaufzug mit Bergmusik, Hauer und Bergschmieden. Also, wie gesagt, Abwechslung gab´s genug auf Helms Berg. Seine Freunde waren jedes Jahr gespannt, was wieder Neues auf den Berg zu sehen sein wird. Dem Helm seine Frau dachte über solche Sachen ganz anders: „ Ich bin nur gespannt“, sagt sie, „wann der ganze Pulverich (Pulverfass, Plunter) einmal zusammen kracht! Auf die dünnen Brettchen geht bald nichts mehr drauf, die biegen sich nach allen Richtungen!“ Der Helm gab keine Antwort. Was verstehen denn die Frauen von der Kunst?, dachte er bei sich.
Wieder einmal war es kurz vor Weihnachten. Spät am Abend saß der Helm nach seiner Arbeit am Weihnachtsberg am Kachelofen. Er war müde zum Einschlafen. Die Augen fielen ihm zu, er nickte ein. Die Uhr (dr Saager) an der Wand tickte dazu. Auf einmal rieb sich der Helm die Augen. Was war denn auf seinem Weihnachtsberg los? Da war doch alles außer Rand und Band! Alle Figuren und (Mannle) Männchen waren lebendig geworden und schrien so durcheinander, dass man kein richtiges Wort verstand. Gleich unter der breiten Straße war ein großes Spektakel. Da stritt sich der Polizist mit dem Förster, weil der über die Straße geschossen hatte. Ein wenig höher, oben auf dem Berg, war gerade die Eisenbahn auf der Brücke entgleist. Der eine Wagen hing in der Luft und konnte jeden Augenblick runter stürzen. Die Fahrgäste bläketen (schrien) aus den Fenstern, dass sie Schadensansprüche stellen würden, denn nur ein großer Schafskopf hätte so eine scharfe Kurve anlegen können. Beim Palast des Herodes waren die Kriegsknechte fleißig beim Zusammenpacken, und auch die Weisen aus dem Morgenland sagten, sie wollten mit abrücken, sie hätten sowieso hier nichts mehr verloren. Adam und Eva schauten aus ihrem finsteren Winkel heraus, wie sie am besten Anschluss finden könnten beim Abmarsch, ohne besonders aufzufallen.
War auf der einen Seite des Berges der Teufel los, so befuhren auf der anderen Seite die Bergleute ruhig ihren Stollen. Durch die Berghäuschen schlängelte sich der Bergaufzug. „So ist es auf der Welt“, sagte der alte Bergmann, der mit seiner Frau auf der Bank vor dem Huthäuschen saß, „Menschen kommen und gehen, aber die Heimat bleibt bestehen! Wenn auch alle von hier weggehen, wir bleiben in unserem Weihnachtsberg, wir bleiben hier!“ „Nun, macht was ihr wollt“, schrien alle durcheinander, die Hirten, der Förster, die Fahrgäste, die Weisen aus dem Morgenland und Adam und Eva, „wir machen fort, aber erst wollen wir noch dem Helm auf den Pelz rücken und ihm unsere Meinung sagen.“ „Jawohl, das wollen wir!“, schrie der Haufen erbosten Volkes – der Helm schwitzte vor Angst – und alle zusammen rückten auf den Helm los, vornweg die Kriegsknechte mit ihren langen Lanzen. Da – auf einmal – ging´s durch den Weihnachtsberg wie ein Erdbeben! Der Boden wankte und knirschte, und (gaahlings) plötzlich gab´s einen großen Krach, alles stürzte runter und zusammen und oben drauf das Häusermeer von Jerusalem! Plötzlich fuhr der Helm von seinem Natzerle (kurzer Schlaf) in die Höhe und rieb sich die Augen. Hatte er geträumt? Was war denn das für ein Krach? Ach du guter Himmel! Der ganze Weihnachtsberg war zusammen gekracht, alles durcheinander, zerbrochen, verbogen, ein einziger Trümmerhaufen! Nur die Seite mit dem Berghäuschen wurde verschont und stand noch. Der Helm schob seine Frau, die erschrocken rein gestürzt kam, vorsichtig zur Türe hinaus. Danach saß er lange vor seinem Trümmerhaufen und in seinem Kopf gingen die Gedanken durcheinander. „In diese Stube kommt mir bis zum Heilgen Abend niemand hinein“, sagte er am nächsten Tag. Und die Frau hörte, wie er in den paar Tagen bis zum Fest jeden Abend lange hinter der verschlossenen Türe arbeitete.
Endlich war der Heilige Abend da. In den Häuschen hatte man schon die Lichter angezündet. In der Küche hantierte die Gottlobin mit den Kochtöpfen und sorgte sich um ihren Mann, der sich in den letzten Tagen kaum Zeit zum Essen genommen hatte. Auf jede Frage sagte er nur: „Warte nur bis zum Heilgen Abend!“ Die Glocken läuteten Weihnachten ein. Da trat der Helm in die Küche. „So, Alte“, sagte er, „nun kannst du kommen, mein Zeug ist fertig!“ Der Gottlobin verschlug es den Atem als sie in die Stube kam. Wie schön war der Weihnachtsberg geworden! Kleiner war er geworden, ein wenig kleiner, aber der Berg war ein Stückchen Heimat. Obenauf standen die Berghäuschen. In den Stollen hämmerten die Bergleute. Vor dem Huthäuschen saß der alte Bergmann mit seiner Frau. Unten war ein Hirte mit seinen Schafen und Ziegen, und auf der anderen Seite sah man einen Holzschlag, Beeren- und Pilzsammler. Ein paar Rehe und Hasen huschten durch das Gebüsch. Auf der breiten Straße kam der Bergaufzug angewalzt. Und das Schönste: In der alten Berghütte, da war das Weihnachtswunder! Hirten und Bergleute brachten dem Christkind Geschenke! Die Lämpchen brannten und die Fenster der Berghäuschen glühten. Ruhig und feierlich kam die Bergparade vorbei gezogen. Es war, als hörte man richtig den alten Bergparademarsch. Heimat, wohin man schaute! Der Helms saß auf der Ofenbank, rauchte seine Pfeife und war zufrieden wie selten in seinem Leben.
* * *
Stephan Dietrich
Stephan Dietrich, genannt Saafenlob (* 17. Februar 1898 in Eibenstock; † 8. Mai 1969 in Hohenlimburg) war Lehrer und ein Heimatdichter des Erzgebirges. Er besuchte von 1912 bis 1919 das Seminar in Schneeberg und war dann als Hilfsschullehrer, Lehrer und Schulleiter in Eibenstock und Wildenthal tätig. Auf seine Initiative wurde in Wildenthal die Grenzlandschule gebaut, die er ab Ostern 1940 leitete. Am 16. Oktober 1921 heiratete er in Eibenstock Edith Geithner. Nach dem Tod seiner Ehefrau verließ er 1967 Eibenstock und lebte bei seinem Sohn Winfried in Hagen. Dort wollte er sein künstlerisches Schaffen fortsetzen, aber ein altes Herzleiden setzte am 8. Mai 1969 seinem Leben ein Ende. Seinem letzten Wunsch folgend, wurde die Urne in der Grabstätte seiner Frau in Eibenstock beigesetzt. Sein Spitzname lautete Saafnlob. So schrieb er sich selbst; verbreitet sind jedoch auch die Schreibweisen Saafenlob und Safnlob. Aus seiner Feder stammen zahlreiche Schnorken, Anekdoten, Kurzgeschichten und Gedichte, die er auch selbst auf Heimatabenden oder im Rundfunk vor trug.
Wo nichts rein kommt...
(Wu nischt neikimmt...)
Der Wolfen-Mann und der Gipp-Ernst hatten sich einmal über das Essen unterhalten. Da sagte der Mann: „nun, ich esse am liebsten Eier, die sind rundherum zu, und man weiß eben, dass nichts Unrechtes hinein kommt, was nicht hinein gehört.“ Da lachte der Gipp-Ernst und meinte: „Nun, ich denke auch so. Ich esse am liebsten Wurst. Die ist vorn und hinten auch zugebunden.“
Der Wolfen-Mann un der Gipp-Ernst hamm sich emol übersch Assen unnerhaltn. Do saat der Mann: „Nu, iech aß am liebstn Eier. Die sei rundüm zu, un mr waß abn, doß nischt Urachts neikimmt, wos net neigehärt.“ Do lachet der Gipp-Ernst und maanet: „Nu iech denk aah esu, Iech aß am liebsten Worscht. Die is hintn un vorne aah zugebundn.“
Die fette Sau
(De fette Sau)
Den Meier-Gulius (Julius) haben seine zwei Freunde aus der Kneipe nach Hause geschafft, weil er ein wenig zu viel geloden (getrunken) hatte und nicht allein gehen konnte. Hüben und drüben haben sie ihn unterm Arm geführt und vorsichtig zu Hause in die Haustüre rein geschoben.
Da kam dem Julius seine Frau dazu und sagte: „Habt nur schönen Dank, ihr Männer, dass ihr ihn mir bringt.“ Da sagte der eine von den zwei Freunden: „Nun, bedanken musst du dich da nicht, als Freund gehört sich das.“ Da meine die Alte giftig: „Ich bedanke mich, wenn ich einen Teller Wurstsuppe bekomme. Da kann ich mich auch bedanken, wenn ihr mir so eine fette Sau nach Hause bringt.“
Der große Durst
(Dr gruße Dorscht)
Der Gevatter (Taufpate) aus Lauter erzählte ein so schöne Geschichte von einem Liebespaar, was eigentlich gar keines war. Der Geier-Os (Oscar Geier) hatte als junger Kerl das Meier-Clärle (Clara Meier) sehr verehrt. Sie sind zusammen zum Tanz gegangen und die Leute sagten: „Aus den zwei Leuten wird ein glückliches Paar.“ Aber es kam anders. In die große Liebe kam der Mard (Marder), wie wir im Gebirge sagen. Auf einmal war es aus mit der Liebe, und kein Mensch wusste warum. Die zwei Leute sind aneinander vorbei gegangen, und keiner schaute den anderen an. Und so sind alle beide ledig geblieben und wurden alte, vergrämte Leute. Der Os hat seine Liebe im Schnaps ersoffen und vergessen. Aber das Clärle dachte noch oft an ihre erste und letzte Liebe. Mit dreiundsechzig Jahren ist der Os gestorben, und viele Leute sind in Lauter mit zu seinem Grab gegangen. Nun, bei einem Begräbnis ist es überall das selbe. Die Frauen gehen mit zum Grab, um ihr bisschen Aputz (Mode, Schmuck) sehen zu lassen, und die Frauen und Männer reden nur über den Toten im Sarg, der sich nicht mehr verteidigen kann. So war es auch beim Os. Alle sagten: „ Um den ist es nicht schade. Der hat sich auch bloß zu tote gesoffen.“ Das Clärle, seine frühere Liebste, hat ihm auch die Ehre gegeben und ist mit ans Grab gegangen und hat sehr geweint und gejammert. Da sagten die Leute neben ihr: „Was heulst du denn so um den Dingerich (Kerl). Damals vor dreißig Jehren hat er dich auch sitzen lassen, und nun ist er auch nur gestorben, weil er so viel gesoffen hat.“ Da sagte das Clärle ganz aufgeregt: „Ich verstehe euch gar nicht, ihr regt euch auf, was der gesoffen hat, aber was er für einen Durst hatte, danach hat keiner gefragt.“
Es hat ein Uhr geschlagen
(´s hot ans geschlogn)
Der Richter-Schorsch (Georg Richter) ist auch so ein Schnookenmacher (Schnorken, witzige Kurzgeschichten). Der alte Richter, dem Schorsch sein Vater, der lief einmal durch einen einsamen Wald vom Jägerhaus nach Sose (Sosa). Da kam mitten im Wald auf einmal ein Handwerksbursche auf ihn zu. Der hatte aber nichts Gutes im Sinn. Das sah man dem Spitzbubengesicht gleich an. Wahrscheinlich brauchte er Geld. Der kam auf den alten Richter zu und fragte so dumm ran: „Wie spät ist es denn?“ - Und dabei schielte er ganz frech auf dessen goldene Uhrkette. Aber der alte Richter roch gleich Lunte, nahm seinen Spazierstock und haute dem Handwerksburschen eins über den Kopf und sagte: „Jetzt hats gerade eins geschlagen.“ Da ist der Spitzbube wie Schafleder ausgerissen. Ganz unten am Waldrand ist er erst stehen geblieben, hat sich den Kopf gerieben und sagte: „Jetzt bin ich aber froh, dass es nicht um zwölf Uhr war.“
Das hilft auch nicht
(Dos hilft aah nett)
Hammerschmiede und Waldleute, das waren unsere alten Leute im Erzgebirge, wie damals in Freiberg, Annaberg und Schneeberg das Berggeschrei erklang. Auch heute ist unser Erzgebirge wieder zum Bergmannsland geworden. Von Annaberg über Johanngeorgenstadt bis zum Vogtland suchen Zehntausende unter unserer Heimat nach Uran und Wismut. Es sind auch noch Bergleute aus der Silberzeit dabei. Neulich, zum Tag des Bergmanns, traf ich in Neustädtel den alten Steiger Börner-Eduward. Der ist schon über achtzig Jahre, aber wenn Bergfest ist, da marschiert er immer mit auf. Der kommt also in seiner Parademontur (Berghabit) beim Neistädtler Rathaus runter, und um ihn herum sehe ich eine ganze Masse Männer, etwa zwanzig. Ich denke: Hoi, was hat denn der Ward (Eduard) heute so viele Leute um sich versammelt und begrüße ihn: „Glück auf, Ward, alter Steiger!“ Da streckt sich seine kleine Gestalt und steht so steif wie eine geschnitzte Figur vor mir, und aus seinen blauen Augen, da strahlt das Licht aus der alten Silberzeit. Ich frag ihn: „Nun, sag nur mal, warum hast du denn die vielen Männer um dich herum?“ Da lacht er und zupft an seinem Spitzbärtchen: „Nu, du dummer Junge, das sind alles meine Jungs. Ich habe heute Geburtstag – zweiundachtzig Jahre bin ich geworden, und da sind sie alle gratulieren gekommen. Es fehlen nur noch zwei Mädchen, die in der Waschleithe verheiratet sind. Aber die bekommen gerade was Kleines und können nicht kommen.“ „Donnerwetter, zwanzig Jungs und zwei Mädchen, das ist allerhand!“ „Ja, mein Lieber“, sagt der Ward, „wie ich damals mein Lenl (Magdalena) aus der Schwefelhütte in Hansgörgnstadt (Johanngeorgenstadt) geheiratet habe, das war ein Fest. Mein Lenl war das schönste Mädchen aus der Stadt. Sie hatte zwar schon ein kleines Mädchen, aber weil sie so schön war, habe ich sie doch geheiratet und hab es auch nicht bereut. Ein Jahr darauf hatten wir schon den ersten Jungen. Ein Jahr darauf wieder einen, das nächste Jahr wieder einen und so ging es jedes Jahr so weiter. Als wir dann den zehnten Jungen hatten, da war es mir dann doch ein wenig zu viel und ich sagte zu meiner Lenl: „Lenl, wenn das so weiter geht, da sind wir dann zu unserer Silberhochzeit dreißig Leute. Wo sollen wir die denn nur unterbringen in unseren zwei Stuben?“ Und meine Lenl hat mit Recht gegeben. Aber das Jahr darauf hatten wir wieder einen Jungen. Als der fünfzehnte ankam da sagte ich zu meinem Lenl: ´Also Lenl, so geht das nicht weiter. Von heute an schlafe ich auf dem Spitzboden´. Da hat sich mein Lenl an mich angelehnt, ein wenig geweint und gesagt: ´Nun ja, du hast schon recht. Wenn du denkst, dass das hilft, da schlafe ich halt auch mit auf dem Spitzboden. ´Siehst du, sagte sie zu mir, und die letzten Fünf, das sind die vom Spitzboden.´“
Der letzte Hammerschmied
(Dr letzte Hammerschmied)
Ich hatte noch als kleiner Junge den letzten Hammerschmied kennen gelernt, so wie sie früher im Hammerwerk waren. Im Frohnauer Hammer, Nietschhammer, Muldenhammer, Wiltzschhammer und wie sie alle hießen. Das war der alte Seff (Josef) im Neidhammer oben auf dem Auersberg. Der Seff war ein großer Dingerich (Kerl). Er trug eine lange Lederschürze, nackte Beine und große Holzlatschen. Auf dem Kopf hatte er einen großen Filzhut, der halb ins Gesicht rein hing, damit beim Schmieden die Funken nicht sein Gesicht fliegen konnten. Wo der hin gedroschen (geschlagen) hat, da wuchs kein Gras mehr. Aber gesoffen hat er auch gerne, denn bei der großen Hitze am Feuer, da bekam er auch Durst. Er ging jeden Abend sein Glas Bier trinken, aber das hat seiner Frau nicht gepasst. Die hatte überhaupt Haare auf den Zähnen, wie man so sagt, wenn eine Frau recht giftig ist. Der Seff wohnte in einem kleinen Gebirgshäuschen, wo man mit der Hand in die Dachrinne greifen konnte. Als nun der Seff am Abend wieder mal in die Kneipe gehen wollte, sein Bier zu trinken, da sagte seine Alte: „ Das Fortgelatsch (Weggehen) jeden Abend hört jetzt auf! Von heute an nehme ich Dir den Hausschlüssel weg.“ Der Seff sagte gar nichts und lachte nur. Ein richtiger Mann reagiert überhaupt am besten, wenn er auf eine solche Fragerei von seiner Frau gar keine Antwort gibt. Am Abend da kam er in den Gasthof und hatte die Haustüre unterm Arm, lehnte sie an die Wand und bestellt ein Bier. Da lachte die ganze Gaststube gerade heraus. Der Wirt fragte: „Nun sag mal, Seff, warum bringst du denn gleich die Haustüre mit?“ Da sagte der Seff ganz trocken: „Nun, wenn meine Alte den Hausschlüssel weg nimmt, da bring ich halt gleich die Haustüre mit.“ So gerade heraus waren bei uns die alten Hammerschmiede.
Die Kirchensteuer
(De Kirchnsteier)
Wenn es ums Bezahlen geht, da sind manche Leute recht faul und langweilig, besonders was die Steuern angeht. Das Kirchenjahr war wieder einmal vorbei und der Pastor Müller überlegte, wie er es machen müsste, die Leute zu mahnen. Die erste Mahnung hatte nicht geholfen. Da hatte er auf einmal einen guten Gedanken. Am Sonntag zu Predigt sagte er von der Kanzel runter: „Meine liebe Gemeinde! Im vergangen Jahr hatte die Gemeinde viele Todesopfer zu beklagen. Es verstarben die treuen Gemeindemitglieder: Max Meier, Peter Müller, Franz Baumgarten, Ernst Mühling... So ging das eine ganze Reihe fort. Da war auf einmal eine Unruhe und ein Gemurmel unten in der Kirche. Was war denn da los? Dort saßen doch all die, die der Pastor eben als Tote verlesen hatte. Da sagte auf einmal der Pastor: „Liebe Gemeinde, es ist mir ein Versehen unterlaufen, die soeben Verlesenen sind nicht tot, und das wollen wir Gott danken. Ich hatte versehentlich statt der Totenliste die Liste derer erwischt, die die Kirchensteuer noch nicht bezahlt haben.“ Nun könnt ihr euch denken , wie die Männer alle mit dicken Köpfen aus der Kirche nach Hause geschlichen sind. Und am nächsten Tag hatte der Pastor alle Steuern rein bekommen.
Der Barbier (Friseur)
(Dr Balwier)
Einmal kam der Amtshauptmann in so ein kleines Grenzdorf und wollte sich dort rasieren lassen. Der Meister selbst lag krank im Bett und es war nur ein kleiner Lehrjunge da, der von der anderen Seite der Grenze stammt. „Bitte rasieren!“ sagte der Herr ziemlich forsch. Der Junge rannte hin und her und suchte das Seifennäpfchen. Aber im Ofentopf war kein Wasser mehr. Die Wasserleitung war von der großen Kälte eingefroren. Das war wirklich ein Unglückstag – und nun auch noch ein fremder Herr zum Rasieren. Sonst kommt so was hier gar nicht rein. Der kleine Lehrjunge rannte in die Küche, aber auch dort war der Ofentopf leer. Da drehte sich der Junge ein wenig herum, spuckte in die linke Hand und rührte mit dem Pinsel auf der Seife herum. Aber in der Brille hatte das der Amtshauptmann gesehen und sagte: „Nun, so eine Schweinerei, du Lauseigel, macht ihr das mmer so?“ Aber das Bürschlein war schlagfertig und sagte: „Nee, das machen wir nur bei Fremden so. Bei Einheimischen spucken wir gleich rein in die Gusch (Mund, hier aber Gesicht).“
Das bisschen Musik
(Is bißl Musik)
Früher kamen von Böhmen drüben, immer die böhmischen Musikanten herüber. Da hatte ich einen gekannt, der immer mit einer Drehorgel kam, wo wir Leierkasten dazu sagen. Es war ein guter Mann und ich hatte immer etwas Mitleid mit dem Alten. Einmal habe ich ihn gefragt, wie er denn so mit seinem Beruf auskommt, so mit dem Leierkastendrehen. Da schaute er mich ganz treuherzig an und sagte: „Nun, wenn ich das bisschen Musik nicht gelernt hätte, müsste ich betteln gehen.“
Der Bass
(Dr Baß)
Was so eine richtige Dorfmusik ist, da hat man schon seine Freude daran. Eine Trompete, eine Klarinette, eine Ziehharmonika und eine Baßgeige, die recht den Takt dazu streicht. Bei uns gibt es viele solche Musikanten. Sie saufen auch gerne ein wenig. Und bei jedem Tanz blassen sie einen aus und rufen anschließend in den Saal: „Was trinkt die Kapelle? Nur Helle!“ Und das geht so oft den ganzen Abend lang, weit über die Polizeistunde hinaus. Am liebsten waren mir die Rittersgrüner. Die hatten einen Baßstreicher, der passte so richtig zu der großen Baßgeige. Ein langer Dingerich (Kerl) mit einer Nase wie ein Tannenzapfen und einen Bart wie ein Rupperich (Nikolaus). Und saufen konnte der. Einmal sind sie im Winter, als so ein Glatteis war, spät in der Nacht nach Hause und hatten ganz schön einen geladen. Da rutschte der Lange mit seinem Baß aus und drüben rein in den Straßengraben. Man hörte nur einen Schrei und ein Geprassel. Und der Lange schrie: „Nun ist mein Baß im Arsch.“ Da lachte sein Freund wie der Lange so in dem Baß saß und sagte: „Nee, der Arsch ist im Baß!“
Der kalte Kaffee
(Dr kalte Kaffee)
In mancher Gegend war schon früher kaum Kultur. Da war oben an der Grenze so eine kleine Gastwirtschaft, da hat einmal ein Mann einen Kaffee bestellt. Die Wirtin bringt den Kaffee, und der Gast trinkt und sagt: „Nun, der Kaffee ist doch eiskalt!“ Da taucht die Wirtin mit dem Zeigefinger in die Tasse rein und sagt: „Ich dächt ober nett!“ (Ich denke, meine aber nicht!)
Stöckraustu
(Wurzeln/Stöcke von abgesägten Bäumen ausgraben)
Holzspitzbuben gibt es im Gebirge auch genug. Das kann man wohl sagen. Die meisten gehören selber zum Wald. Wie ich das meine, das könnt ihr euch wohl denken. Einmal sind ein paar solche Dingeriche (Kerle) am Sonntag früh raus in den Wald und haben sich gleich über einen großen Baum her gemacht. Sie haben ihn erst unten am Boden aufgehackt, weil sie gleich den Stock (Wurzel) mit haben wollten. Wie sie mitten in der schönsten Arbeit sind, kommt der Förster dazu. „Na, ihr Spitzbuben,“ sagte er, „ was macht ihr denn hier?“ Da schauten die ganz verwundert in die Höhe und sagten: „Wir, wir, nun wir graben Stöcke (Wurzeln) aus.“ „Das sieht schon aus wie Stöckraustun“, schrie der Förster, „seht ihr denn nicht, dass oben noch der Baum steht?!“ Da gaben sich die Spitzbuben ganz verwundert und sagten: „Ja, wenn wir hier unten arbeiten, da schauen wir doch nicht in die Höhe. - Donnerwetter! - da ist doch noch der ganze Baum dran.“
Das Weihnachtsbäumchen
(Is Weihnachtsbaaml)
Wenn es Weihnachten im Gebirge wird, da ist bei uns jeder ganz wild darauf, dass zur rechten Zeit ein Bäumchen ins Haus kommt, ein richtiges Tannenbäumchen. Da sind die Leute bei uns wählerisch. Der Baum muss gute Quirl haben, das heißt, die Äste müssen schön genau gegenüber stehen und es darf auch keiner fehlen. Am besten ist es, man kauft so einen Baum gar nicht, weil man im großen und ganzen nehmen muss, was da so aus dem Wald raus geschlagen wird. Das beste ist es aber, man maust (klaut) sich einen Baum, ohne dass man erwischt wird. Der Seffgung (der Junge vom Josef) und der Schmiedhannes (Johannes Schmied) sind nun auch einmal kurz vor Weihnachten raus in den Wald auf Suche nach einen schönen Baum gegangen. Der Seffgung hat die Säge mitgenommen und der Schmiedhannes einen langen Strick. Mit den kleinen Fichtlein ist das nichts. Man muss von einem großen Baum die Spitze nehmen, die ist kräftig und hat auch meistens einen schönen Quirl. Da hatten sie auch bald einen Baum gefunden, der oben raus schön gewachsen war. Der Hannes kletterte nun rauf, bindet den Strick um die Spitze, damit der Seff den Baum herunter biegen und abschneiden kann. Der Seff wartet unten mit der Säge. Als der Seff gerade das eine Ende vom Strick runter schmeißen will, kommt auf einmal der Förster und schreit: „Nu, Donnerwetter, ihr verdammten Spitzbuben. Was macht ihr denn da?!“ Da sagte der Hannes: „Pscht, Herr Förster, stören sie den Hannes nicht. Sie sehen doch, der hat einen Strick. Der will sich nämlich aufhängen, und ich warte hier unten und will ihn nachher abschneiden.“
Die Weihnachtsgans
(De Weihnachtsgans)
Spitzbuben laufen überall auf der Welt genug herum. Wir erkennen sie nur nicht gleich alle. Da sind auch mal zwei solche Halunken kurz vor Weihnachten in unser Dorf gekommen. Als sie beim Häuschen vom Franz vorbei gingen, sahen sie gerade, wie der Franz auf dem Hof eine Gans, ein schönes fettiges Tier, geschlachtet hat. Sie haben sich nun ein wenig in der Nähe herum gedrückt und beobachtet, wie der Franz die schöne Weihnachtsgans nach einer Weile oben am Hausgiebel an einen Haken hängt. Nun sind doch die Häuschen bei uns oben nicht so sehr hoch, und es ist doch für die Spitzbuben gar nicht so schwer, dahin zu kommen, wo sie hin wollen. Die beiden haben sich nun zugezwinkert. Sie sind ein wenig spazieren gegangen, und wie es draußen finster wurde und ein wenig zu schneien anfing, da haben sie sich zum Franzelhäuschen geschlichen, haben ganz frech vom Hof die Leiter an den Giebel gelehnt, und der eine ist hinauf geklettert und wollte nun die Gans runter holen. Da kam ganz durch Zufall unser Schutzmann um die Ecke herum, sieht den da oben und schreit: „Nun, was machen denn sie da oben, he?“ Da meinte der andere, der unten Schmiere stand: „Herr Schutzmann, das ist eine Überraschung, schreien sie nur nicht so, sonst verderben sie uns noch den Spaß. Der Franz ist doch ein Freund von uns noch aus dem Krieg, und der hat doch morgen seinen Geburtstag. Der soll sich freuen, wenn er morgen früh das Schlafstubenfenster aufmacht, hängt als Geschenk eine Weihnachtsgans daran.“ „Nun hört mal zu“, sagte der Schutzmann, „so was könnt ihr doch auch am Tag machen un d nicht in der halben Nacht, wo es verdächtig aussieht.“ „Nun, da haben sie auch recht, Herr Schutzmann“, sagte der eine und rief zu seinem Freud hinauf: „Emil komm wieder runter. Bring die Gans wieder mit. Wir hängen sie morgen früh rauf.“
* * *
Herbert Köhler
Herbert Köhler ist als Nachkomme von schottischen Einwanderern am 9. Juli 1906 in Limbach geboren. Mutter und Vater waren Handschuhmacher, zum Teil in Heimarbeit. Nach dem Besuch der Oberrealschule in Aue nahm er 1921 er eine Lehre als Handschuhmacher auf. Anschließend erlernte er noch den Kaufmannberuf – ab 1946 Exportkaufmann - in dem er auch die überwiegende Zeit gearbeitet hat. Im Zweiten Weltkrieg war er u.a. in Belgien eingesetzt, dort entstand aus Heimweh seine erste Mundartgeschichte, der in der späteren Zeit über 70 weitere Geschichten und Gedichte sowie zahlreiche heimatkundliche Beiträge folgten. Sein Gedicht „Die Schwelle“ wurde 1956 vom Rat des Kreises Annaberg ausgezeichnet. Nebenberuflich wurde er ab 1956 als Mitarbeiter des Wörterbuches der obersächsischen Mundartforschung bei der Sächsischen Akademie der Wissenschaften zu Leipzig aktiv. Ferner war der Redaktionsmitarbeiter der Heimatzeitschrift „Der Heimatfreund für das Erzgebirge“. Er starb 1982 in Limbach-Oberfrohna. Die folgende Erzählung entstand im Jahre 1956:

Ein Heinzelmännchen von heute
(E Heinzelmannl von heitzetog)
An der Chaussee haben sie Bäumchen gepflanzt, Apfelbäumchen. Wie sich das gehört, wurden Baumpfähle eingeschlagen und die Bäumchen angebunden. Aber Wind und Wetter und nicht selten auch der oder jener Stoß lassen keine Ruhe. Ein Pfahl wird abgebrochen, hier ist ein Band gerissen, da haben sie ein Ästlein abgebrochen. Wenn es so weiter geht, sind die Bäumchen zum Teufel. Die ganze Arbeit war umsonst und ein Haufen Geld ist im Eimer, wenn sich niemand um die Sache kümmert. Tausend Menschen gehen vorbei und sehen die Bescherung – und gehen weiter. Was geht es denn mich an, denken sie. Ist alles wieder im schönsten Lot. Die Pfähle sind frisch eingeschlagen, die Bäumchen neu angebunden, die geknickten Äste ordentlich abgeschnitten. Man könnte glauben, die Straßenwärter wären da gewesen. Nein, es hatte sich keiner sehen lassen. Gibt es am Ende noch Heinzelmännchen wie einst in Köln? Mit der Zeit bin ich zu der Überzeugung gekommen, dass es zumindest noch eins gibt. Nur dass das Männchen nicht Heinzel heißt, sondern Fröhner-Hermann und ein alter Rentner ist. Wenn der Hermann seine Wanne voll Asche und Geröll zum Schutzplatz zerrt, schaut er bald links, bald rechts in den Straßengraben. Was da andere Leute für Müll rein geworfen haben: leere Flaschen, zerbrochene Matratzenfedern und was weiß ich alles noch, das holt der Hermann raus und fährt es zusammen mit seinem Geröll zum Schuttplatz. An der Straßenecke haben sie eine Fuhre Steinsand hin geschüttet, aber so, dass der größte Teil davon jederzeit von Fahrzeugen zusammen gewalzt wird wie ein Kartoffelkuchen. Bevor sei dazu kommen, mit dem Sand die Straße auszubessern, ist davon nicht mehr viel zu sehen. Das heißt, wenn der Hermann nicht wäre. Früh, beim ersten Hahnenschrei, war er zu Gange und schaufelte den Sand zur Seite. Nicht etwas deswegen, dass es alle sehen sollten. Bewahre! Im Gegenteil, so heimlich wie nur möglich.
Im Frühjahr, wenn es plötzlich taut und es regnet noch dazu, was vom Himmel runter kann, sind meistens die Schleusendeckel verstopft. Die Straße schwimmt bald weg. Da dauert es nicht lang und der Hermann stapft durch den Matsch so lange herum, bis er mit seiner kleinen Hacke die Schleuse sauber hat. Danach steht er erst noch eine Weile dabei und freut sich wie ein Kind, wenn aus der breiten Bach langsam wieder eine Straße wird. Der Hermann macht kein Aufheben um seine Hantiererei, und er kann es auch auf den Tod nicht leiden wenn andere darüber sprechen. Einmal, als der Hermann wieder mal im Vorbeigehen ein Straßenbäumchen an band, kam sein Nachbar dazu und meinte so von oben herab: „Aber Hermann, ist das denn deine Sache?“ Da schaute er nur recht ernst und sagte: „Ja, das ist meine Sache und deine Sache und allen ihre! Wenn einen alles gehören soll, muß man sich auch um alles kümmern!“ Sagte es und ging seiner Wege.
* * *
Karl Hans Pollmer
Karl Hans Pollmer-Geyer, geboren am 12. Oktober 1911 in Herold und verstorben am 2. Juni 1987 in Dresden, ist der ältere Bruder des Mundartdichters Manfred Pollmer (1922-2000). Beide sind Söhne eines Strumpfwirkers und einer Heimarbeiterin. Karl Hans studierte Theologie und Philosophie und wurde Pastor der Evangelisch-methodistische Kirche zunächst in Geyer (deshalb auch der Namenszusatz), wo er auch seine Kindheit und Jugend verbrachte, und dann ab 1955 in Zschorlau. Die letzten Lebensjahre verbrachte er in Dresden. Als Mundartdichter und Heimatforscher schrieb und veröffentlichte er zahlreiche Gedichte, Lieder, Erzählungen und Laienspiele in Mundart sowie Beiträge zur Heimatgeschichte. Die hier übertragene Erzählung „Mei Mutter“ schrieb er im Jahre 1955: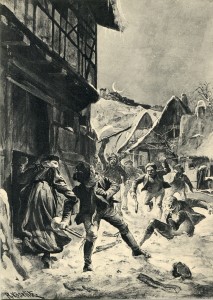
Meine Mutter
(Mei Mutter)
Wenn ich an meine Kinderzeit denke und an die Zeit, als ich aus der Schule kam und trotzdem noch in die Schule ging, da sah ich vor mir immer meine Mutter, und ich sah sie immer so: Wie sie an der Kettelmaschine saß – die Füße traten die Maschine, die Finger zupften die Fäden, die Augen waren gespannt auf die Arbeit gerichtet. Manches mal bin ich aus der Schule nach Hause gekommen und meine Mutter ist nicht von ihrem Platz am Fenster weg gegangen, kaum, dass sie her schaute. Sie sagte dann immer nur: „Junge, nimm dir eine Bemme (Scheibe Brot)!“ Ich habe mir manche Bemme selbst genommen. Jetzt weiß ich: Dass ich sie mir nehmen konnte, ich meinen das Brot, und da war auch was zum drauf schmieren, das hing auch damit zusammen, weil meine Mutter von früh bis Abend ein Paar Strümpfe nach dem anderen gekettelt hat. Und auch, dass ich in die Schule gehen und etwas lernen konnte. So manches im Leben versteht man erst später. Als Junge hab ich so manches mal an mich gedacht: Die anderen Kinder gehen mit ihrer Mutter spazieren, die gehen mit ihrer Mutter hinaus in den Wald, in die Beeren und die Schwamme (Pilze), und auch mal so, warum die Mutter keinmal mitgeht, immer sitzt sie zu Hause, immer hat sie zu tun, notwendig, notwendig... Das waren manches mal so meine Gedanken. Aber jetzt weiß ich, warum das so war. - Einmal bin ich früh aufgestanden. Ich musste in die Schule und wachte immer von alleine auf. Das war immer so etwa gegen viertel acht. Als ich in die Stube kam, saß meine Mutter an der Kettelmaschine, die Arme auf die Maschine gelegt, den Kopf auf den Armen und schlief. Da wusste ich, dass sie in dieser Nacht nicht ins Bett gegangen und während der Arbeit eingeschlafen war. Da hab ich mich aber etwas geschämt. Ich weiß auch nicht, warum. Vielleicht, weil wir solch arme Leute waren, dass meine Mutter die ganze Nacht durch ketteln muss? Oder aber, weil ich geschlafen hatte, während meine Mutter arbeiten musste? Ich weiß auch nicht, warum? Ich weiß nur noch, dass ich ganz leise gemacht habe und dass ich nachher das Kissen genommen und es ihr unter die Arme geschoben habe, damit sie nicht so hart auf der Maschine liegt. Aber darüber ist sie aufgewacht. Da habe ich mich noch mehr geschämt. Aber meine Mutter hat mich gestreichelt – zum ersten Mal, dass ich mich auf so was besinnen kann! - und hat zu mir gesagt: „Du bist ein guter Junge!“ Und sie gab mir das Kissen wieder und kettelte weiter. - Wenn ich daran denke, dann weiß ich nicht, was ich sagen soll. „Mutter“, möchte ich sagen, „wenn ich ein guter Junge war – was warst denn dann du?“
* * *
Walter Findeisen
Guido Walter Findeisen wurde 7. Dezember 1903 als das zehnte Kind eines Brettschneiders und Holzdrechslers in Wünschendorf geboren. Er starb am 18. September 1986 in Lengefeld. Er lernte Buchdrucker in Lengefeld. Autodidaktisch eignete er sich Kenntnisse auf dem Gebiet der Heimatliteratur an und verfasste mehrere eigene Erzählungen und Theaterstücke, die zunächst im Pöhlbergverlag und im Verlag Graser in Annaberg erschienen sind. Überregional bekannt wurde er durch die Herausgabe des Erzgebirgischen Heimat-Kalenders in den Jahren 1934 bis 1942. Nach dem Zweiten Weltkrieg gab er mehrere humorvolle Mundart-Publikationen, darunter auch Theaterstück, in seinem eigenen Heimat-Verlag heraus. Darunter auch die lustigen Erzgebirgserlebnisse in seinem Büchlein „Liebelei im Arzgebirg“, dem wir die folgenden Übertragungen entnahmen:
Ein einträgliches Geschäft
(E eiträglich Geschäft)
Zöppels Kurtl (Kurt Zöppel) war in seinen Sturm- und Drangjahren überall auf den Tanzsälen herum schwadroniert und dabei war er auch einmal in Schindelbach an ein Mädchen geraten, das so recht nach seinem Geschmack war: groß und stark, schön zum Ansehen, frisch und lebhaft in der ganzen Art. Das gefiel dem Kurt. Er schaffte das Mädchen einmal nach Hause, zweimal, dreimal, - zuletzt ging er auch in der Woche zu ihr zum Vergnügen und es hatte den Anschein, als ob eine feste Sache daraus würde. Das Mädchen hatte aber auch eine besondere Art, einen Kerl für sich einzunehmen. Sie hat sozusagen Geschick, mit den Männern umzugehen und die Kerle von der richtigen Seite zu nehmen. Und so brachte sie es eines Abends, als der Kurt wieder allein mit ihr auf dem Kanapee saß, aus freien Stücken fertig zu sagen: „Weißt du was, Kurt, wir legen uns eine Sparbüchse an, da können wir schön langsam Geld für unsere Hochzeit zusammen sparen. Wir machen es so: Für jeden Schmatz steckst du mir immer einen Fünfer in die Sparbüchse! Sollst mal sehen, was wir da zusammen bringen!“ Der Kurt war ganz baff. Für jeden Schmatz einen Fünfer..., einen Fünfer...? Eine ganze Zeit musste er sein bisschen Mathematik aufbieten, um das Exempel heraus zu bekommen. Fünfer hin und her. Ein Fünfer alleine ist wäre nicht viel, aber mit der Zeit kann das ein teurer Spaß werden. So überlegte er. Aber mit der Masse könnte es man doch einrichten. Schließlich war ihm ja das Mädchen recht lieb, da wäre schon jeder Schmatz einen Fünfer wert. Er sprang also drauf, auf den Vorschlag. Auf der Kommode stand fortan eine blecherne Sparbüchse. Und jedes mal, wenn der Kurt zu seinem Mädchen kam, hatte er die Tasche voller einzelner Fünfer. Bei jedem Schmatz wurde einer davon gewissenhaft in die Sparbüchse rein gesteckt. Mit der Zeit wurde das zu einer richtigen Gewohnheit und machte ordentlich Freude.
Da nun der Kurt von Natur aus ein wenig geizig und zugeknöpft war, da hatte er immer nur seine Sorge damit, dass jeder Schmatz auch richtig lange ausgeteilt wurde, damit er mit jedem guten Fünfer auch auf seine Kosten kam. Und er kam auch bestimmt auf seine Kosten, dafür sorgte schon recht gut das lebhafte Mädchen. Zuletzt hatte der Kurt nur noch Freude an dieser Einrichtung, denn für das Sparen war er sowieso wie der Teufel auf die Seele. Er meinte, durch diese Art braucht man in keinen Sparverein zu gehen.
Als das Mädchen nun Geburtstag hatte und der Kurt auch wieder bei ihr saß, da sagte er: „Wir wollen doch mal sehen, wie viel schon in unserer Sparbüchse drinnen ist...“
Das Mädchen wollte eigentlich nichts davon wissen. Sie sagte, es wäre doch am besten, sie zu Weihnachten zu öffnen, eventuell zur Verlobung. Der Kurt aber ließ nicht locker. Die Sparbüchse wäre auch schon schwer genug, meinte er. Denn man glaubt gar nicht, was man in paar Wochen so zusammenschmatzen kann. An manchen Abenden wäre es dem Kurt bald zu teuer geworden, so viele Fünfer hat er berappen müssen. Öfters hatte er schon vorgeschlagen, den Preis lieber auf einen Dreier oder auf zwei Pfennige runter zu setzen. Darauf hat sich das Mädchen aber nicht eingelassen. Sie hätte feste Preise, sagte sie. Und so sind vom Kurt immer nur Fünfer in die Büchse rein gekommen.
Am Geburtstag also wurde die Sparbüchse doch noch geöffnet. Das Mädchen holte den passenden Schlüssel dazu aus dem Glasschrank aus dem Kaffeetöpfchen und schloss die Sparbüchse behutsam aus. Der ganze viele Inhalt wurde nun mit einem Schwung auf de Tisch geschüttet und der Kurt wollte gleich heimlich anfangen zu zählen. Da kam aus dem Haufen von Fünfern, aus den zusammen gesparten Schmatzfünfern, auf einmal auch ein Neugroschen heraus gerollt. Der Kurt machte große Augen. Wie kam denn der Neugroschen da hinein? Seine Augen wurden immer größer, als später noch ein paar Neugroschen und gar eine Reihe Fünfziger zum Vorschein kamen. Nie hat er solche Geldstücken in die Sparbüchse gesteckt...! Er schaute das Mädchen ganz verwundert an. Das war aber gar nicht verlegen. Und als er sie fragte, wie denn solche fremde Geldstücke da hinein gekommen sind, da zwinkerte sie ihn listig mit den Augen von der Seite an und sagte: „Du dummes Luder du, - - es sind doch nicht alle so geizig und knausrig wie du...!“
Kurt wusste Bescheid. Stillschweigend ging er seine Wege und ist nie wieder nach Schindelbach gekommen.
Eine furchtbare Rache
(Ene furchtbare Rach´)
Weiß der Teufel, wie das bei manchen Mädchen so ist – da traut sich sonst kein Kerl ran, da will einfach keiner hängen bleiben. Da wird so manches Mädchen älter und älter, aber zum Heiraten kommt sie nicht. So eine war auch die Schuster-Hanne. Sie war auch schon stark in dem Alter wo man sagt, sie muss nun an den Mann gebracht werden. Aber keiner der vielen Bussen (Bosse, Kerle) machte eine Anstalt, sich an die Hanne fest ran zu machen. Sie war durchaus nicht ganz unrecht, man kann aber auch nicht sagen, dass sie eine Schönheit war. So mittlerer Durchschnitt wo man am besten – doch einen Bogen drumherum macht. Ein bisschen klein war sie. Es hieß auch, sie hätte krumme Dackelbeine, - aber das konnte man nicht genau feststellen, denn die Hanne hat die neue Mode mit den ganz kurzen Röcken noch nicht mitgemacht.
Einmal saß nun die Schuster-Hanne auch wieder ein Mauerblümchen auf dem Tanzsaal. Kaum ein paar Anstandstouren waren mit ihr getanzt worden, während die anderen Mädchen jede Tour auf Tour herum geschwenkt wurden. Da sagte der Bäcken-Willy zum Half und zum Hoppe-Hug, der gerade aus Chemnitz zu Besuch da war, nachdem sie schon etliche Faustpinsel (Biere) zusammen getrunken hatten und in angeregter Stimmung waren: „Kommt, jetzt machen wir einen Spaß mit der Schuster-Hanne! - Wir tanzen reihum nur noch mit ihr, sie darf gar nicht mehr zur Ruhe kommen. Und jeder sagt zu ihr, er möchte sie heute nach Hause bringen.“
Der Vorschlag war angenommen und die Tanzerei ging auch gleich los. Der Reihe nach fragte ein jeder die freudestrahlende Hanne wegen der Heimfuhr. Gleich zum ersten sagte sie „Ja,“ - das war der Hug aus Chemnitz. Und der zweite, das war der Bäcken-Willy, der machte ein bedauerliches Gesicht als ihm die Hanne sagte, dass sie schon einen Heimführer habe. Er hätte sie doch auch zu gerne mal nach Hause geschafft, sagte er scheinheilig. Das sie aber nun schon einen andere dafür hat, da würde er sie gerne mal für den Mittwochabend zum Spaziergang bestellen. Die Hanne dachte sich nichts Schlechtes dabei, es war eben mal ein Glückstag für sie. Uns so sagte sie zu, am Mittwochabend um acht Uhr raus zum Birkenbusch zu kommen. Sie geriet ganz außer sich vor Freude, denn wenn ein Kerl mit einem Mädchen raus zum Birkenbusch gehen will, dann sollte das schon was heißen...! Der Willy fragte sie noch paar mal, ob sie auch bestimmt kommen würde, da sagte sie: „Bestimmt! Ich komme bestimmt, kannst dich ´drauf verlassen!“ Der Tanz ging bald zu Ende, da hatten sich die drei Kerle stillschweigend verkrümelt. Der Hug dachte gar nicht daran, die Hanne nach Haus zu schaffen, der nicht, nein, der hat schon in Chemnitz genug schöne Mädchen. Die Hanne stand danach noch lange unten in der Schenke und wartete umsonst. Zuletzt war sie ärgerlich und musste doch alleine in der Finsternis nach Hause gehen. Wo sie sich gerde so darauf gefreut hatte...!
Am nächsten Mittwochabend ging es ihr nicht viel besser. Sie war wirklich zeitig genug und voller Erwartungen draußen beim Birkenbusch, aber wie sei auch wartet und wartet, - der Bäcken-Willy kam nicht. Sie sah es nachher bald ein, dass sie von den Kerlen ganz granatig veralbert (gefoppt) worden war.
Nach einer längeren Zeit kam der Hoppe-Hug auch wieder einmal von Chemnitz rauf. Er traf den Half. Gleich ragte er: „Wie ist denn damals das Ding mit der Schuster-Hanne ausgegangen? Der Willy hatte sie doch zum Mittwoch bestellt?“ „Du“, sagt der Half da vorsichtig, „da ist eine dumme Sache daraus geworden! Da wollen wir froh sein, dass es uns zwei nicht erwischt hat! Die Hanne hat sich furchtbar gerächt...!“ „O liebster Gott!“ erschrak da der Hug, „sie at doch nicht etwa den Willy vergiftet...?“ Da sagte der Half: „Aber bald so ähnlich..., - sie hat den Willy - - geheiratet!“
Ein gutes Rezept
(E gut Rezept)
Die Räsch-Fritzn-Christel (Christel, die Frau vom Fritz Räsch) hat schon vier Freier hintereinander gehabt, mit zweien davon war sie schon fest verlobt, aber jedes mal ging die Sache wieder aus dem Leim. Ein Wunder war das allerdings nicht, denn die Christel hat nämliche ein solche lose Gusch (Mund), dass den Kerlen schon vorn weg himmelangst vor ihr war. Keiner wollte sich zeitlebens unter solch ein Schnattergusch-Regiment stellen. Eigentlich wäre es schade um die Christel, denn sie war wirklich ein schönes Mädchen, in der Wirtschaft war sie tüchtig und an einem guten Heiratsgut (Mitgift) ließ es der Vater auch nicht fehlen. Als fünfter Freier kam nun bald einer aus der Scheib (aus Scheibenberg), der ging eine Weile mit der Chrisel. Nicht lange dauerte es, da ging das alte Theater wieder los. Die Christel konnte eben ihre Dreckschleuder nicht bezähmen und alle Leute bekitzelten sich schon schadenfroh, dass auch der Kerl bald wieder abhauen würde. Aber diesmal nicht. Im Gegenteil: Bald fand die Hochzeit mit dem Scheibner Kerl und der Christel statt. Auch am Hochzeitstag fing die Christel Krawall an, aber ihr junger Mann blieb still und ertrug das Schicksal ergeben.
Schon acht Tage nach der Hochzeit war Ruhe geblasen. Das ganze Dorf wunderte sich blau, wie auf einem mal die Christel so ruhig geworden war. Alle Leute dachten, das wäre nur eine kurze Pause, aber ein, es blieb still um die Christel und sie führte mit ihrem Mann eine gute Ehe. Nach einer gewissen Zeit fragte einer ganz verstohlen, der auch so eine Zankbase zu Hause hat, den zufriedenen Ehemann, wie er das mit der Christel zu wege gebracht hätte. Da lachte der: „Ganz einfach Ich habe der Christel ein Töpfchen Honig auf den Scheunenboden gestellt, und als ich sie so richtig beim Lecken erwischt hatte, da habe ich sie vom Scheunenboden auf die Tenne runter ins Stroh fallen lassen, weißt du, so... - dabei hat sei sich die Zungenspitze abgebissen. Aus war es mit einem mal mit der losen Gusch´, - hihihihi!“
Familien Tragödie
(Familgen Tragödie)
Im ganzen Dorf war es reichlich bekannt, dass beim Dillig-Emil in der Ehe andauernd ein wenig Krawall war. Man möchte sagen, der häusliche Krieg war hier schon zum Dreißigjährigen Krieg geworden. Die Male (Marlene/Magdalena) war aber auch ein Weib wie aus einem Butterfass gezogen: Groß und stark, das Maul am rechten Fleck, und mit den Händen, da wusste sie allerhand anzufangen. Nun, der kleine Emil wusste davon schon ein Lied zu singen. Einmal an einem Vormittag gab es auch wieder wegen einer Kleinigkeit solch einen unruhigen Gedankenaustausch. Der Emil fürchtete sich diesmal nicht gleich wieder, weil er im Recht war. Und so wurde die Streiterei bald stürmischer. Zuletzt kam es wieder – wie schon ein paar mal – zum Ausdruck der schönsten Menschenliebe, das heißt, sie fingen eine Schmeißerei an (bewarfen sich) mit Töpfen, Stiefelknecht, Vasen und solchem Zeug. Bald war der schönste Windbruch in der Stube angerichtet. In der einen Ecke stand die Male, hoch aufgerichtet wie ein Kampfhahn. In der anderen Ecke lauerte der Emil auf das nächste Hagelwetter. In dieser Situation kam gerade der Briefträger zur Türe rein, und schaute sich verwundet das Geschmeiß an. Da sagte die Male geschwind zu ihm: „Na, Ernst, was sagst du denn dazu...?“ Bevor aber der Briefträger etwas sagen konnte, da sagte auch der Dilig-Emil: „Na, Ernst, - was sagst du denn dazu...?“ Der Briefträger sah sich in der ganzen Stube um und wusste auch nicht recht, was er sagen sollte, ob der Male oder dem Emil zu Gunsten. Nach einer Weile sagte er bedächtig: „Nun, was soll ich denn dazu sagen...? Gesehen habe ich nichts. Da müsst ihr schon gleich noch mal von vorne anfangen...!“ Er gab den Brief bei der Male ab und ging.
Dreierlei Tee
(Dreierlaa Tee)
Der Neibauer-Arnst (Ernst Neubauer) war sein Leben lang auch so ein Urian (Urvieh/Spaßvogel), der andauernd nur Unsinn mit den Weibern im Kopf hatte. Wenn der einem Weib ein Ding drehen konnte, dann tat er das auch. So war es schlimm genug in seinen jungen Jahren, und so war es auch geblieben, als er schon grauköpfig herum lief. Vom Arnst kann so manches Mädchen ein Liedchen singen, von dem sie heute noch nicht weiß, ob es in A-Dur oder Cis-moll begann.
In Raunstää (Rauenstein) unter der Brücke war doch früher das kleine Lädchen von der Baldauf-Christ (Christine Baldauf). Da gab es allerhand Zeug zu kaufen: Haaring (Heringe), Bittling (Bücklinge), Leinöl, Tietelzeig (Mehl, Zucker u.ä. in der Tüte) und auch viele Sorten Tee, den die Christ zumeist das ganze Jahr über selbst gesammelt hat. In das Lädchen kam nun auch mal der Neibauer-Arnst zur alten Christ. Seine alte Liebe zur Christ aus der Jugendzeit war trotz der grauen Haare immer noch nicht ganz erloschen, denn es machte dem Arnst allezeit noch ein Heidenvergnügen, mit der Christ ein wenig herum zu schäckern, so, als wären sie sonst wie jung, als wollten sie alle Tage noch auf dem Rauensteiner Tanzsaal ihren Dreher herum wälzen. Man möchte doch meinen: Alte Liebe rostet nicht... - oder auch: Alter schützt vor Torheit nicht...! Wie man es eben so nimmt.
Da kam also der Arnst auch wieder mal zur Christ in das Lädchen und sagte: „Christel, ich hab solche Kopfschmerzen, mir zertreibt es bald den Nischl (Kopf/Schädel), - gib mir nur mal ein Tütchen Pfefferminztee.“ Die Christel sagte: „Ja, mein guter Arnst, da kann ich dir aber nur Pfefferminze geben, den Tee musste dir schon selber davon machen.“ Er bekam ein Tütchen für einen Neugroschen und ging damit den Berg hinauf. Etwa vierzehn Tage darauf kommt der Arnst wieder zur Christ rein und sagt: „Christel, mich friert es andauernd wie einen jungen Hund, - nicht mal ein Korn hilft mir mehr, - gib mir nur mal gleich zum Schwitzen ein Tütchen Lindenblütentee...“. Die Christel sagte da wieder: „Lindenblüten kannst du schon von mir bekommen, den Tee musste aber selber davon machen...“.
Ein wenig nachdenklich gng diesmal der Arnst den Berg hinauf, als wenn er sich was überlegen würde. Und waßterhole (was soll ich sagen), schon nach paar Tagen kam er wieder zur Christ: „Christel, gib mir nur mal ein Tütchen Brust-Tee...“. Die Christel wollte sogleich wieder mit ihrem gewohnten Latein anfangen, von wegen Brust und den Tee selber machen, - aber da drehte sie sich geschwind herum und füllte das Tütchen Brust-Tee ein, ohne etwas dazu zu sagen. Diesmal funktionierte das Verslein nicht...!
Der Arnst aber, das huhnackete Luder (Mensch, der andere gerne foppt, aufzieht), hatte allerhand zu tun, damit er schnell zur Ladentüre raus kam. Den Berg hinauf schaffte er es kaum vor Lachen...
Kuss-Raten
(Schmatz-Rooten)
Wenn im Erzgebirge die langen Winterabende anfangen, dann wird in den Hutzenstuben (früher einzige beheizte Stube, in der erzählt, gesungen und Handarbeiten gemacht wurden) mancherlei Lust und putziges Zeug ausgeheckt, insbesondere von den jungen Leuten. Dort waren in der Gesindestube allerhand junge Leute, der Großknecht, zwei Holzknechte, zwei Ackerknechte, zwei Kuhjungen, die Großmagd, die Milchmamsell, zwei Stallmädchen, zwei Kälbermädchen, ein Schweinemädchen und auch noch das Laufmädchen. Als das Abendessen vorbei war, ging es oft in der Gesindestube hoch her, denn der eine Holzknecht konnte schön Ziehharmenie (Ziehharonika/Akkordeon) und der Großknecht war besonders gut im Schnorken erzählen.
An den letzten Tagen hat nun der Horn-Hardl (Harald Horn), der Bauer, auffallend bemerkt, dass es drüben bei seinen Leuten ganz besonders hoch her ging. Er hat da nichts dagegen, denn junges Volk muss ja auch sein Vergnügen haben, wenn es die Arbeit gut gemacht hat. Und darüber gab es in Horn-Hardls Gut nie eine Klage, da ging alles gut Hand in Hand. Aber das Gelache und Gequike fiel ihm auf. Mehrmals unterbrach er sein bedächtiges Zeitungslesen und horchte. Er war ganz allein in seiner Stube. Am andere Tag war er einmal eine Weile alleine mit dem Großknecht in der Scheune, da musste er aus Neugier fragen, was sie da andauernd abends in der Gesindestube für einen Spaß hätten. Der Knecht wollte nicht recht damit raus rücken, aber der Bauer sprach ihm gut zu, und da erzählte er. Sie würden jetzt jeden Abend - Schmatz-Rooten (Kuss-Raten) machen. Der Bauer war ganz baff. „Schmatz-Rooten...?“ fragte er, „was ist denn das?“ „Ach“, sagte der Knecht ungeniert, „das ist ein schönes Spiel mit viel Spaß...“
„Das musste mir erzählen! Komm, sag es!“ eiferte der Hardl. Und seelenruhig erzählte der Knecht: „Da werden bei einem oder bei einer – wer nun gerade dran ist – die Augen zugebunden, die anderen stellen sich durcheinander, bis der mit den zugebundenen Augen, so wie bei der Blindenkuh, herumgedreht wurde. Dann gibt ihm nun jemand einen Schmatz und dabei muss er merken und raten, wer das ist, den er festhält und schmatzt. Wenn einer zwei Mal verkehrt geraten hat, muss er einen Fünfziger Strafe zahlen und dafür hohlen wir uns am Schluss dann eine Flasche Schnaps aus der Schenke und trinken sie gemeinsam aus. Gestern haben wir drei Flaschen ausgenippelt, da ist uns bisschen schlecht davon geworden.
Der Bauer war baff. Wirklich baff. So was hat er in seinem ganzen Leben noch nicht mitgemacht. Er bekam Appetit und wischte sich mehrmals seinen Mund ab. Und zuletzt konnte er sich nicht mehr beherrschen, da sagte er leise zum Knecht: „Du hör mal, da würde ich auch mal gerne mithelfen, - mir kommt es auch auf eine ganze Flasche Schnaps nicht an!“ Der Knecht lachte nur und sagte, da wäre weiter nichts dabei, er soll nur heute Abend mal rüber kommen. Der Bauer war aber noch etwas schüchtern und vorsichtig. Er sagte: „Ich komme schon, - aber – ihr müsst mir versprechen, dass ihr davon meiner Frau nichts...!“ Da winkte der Großknecht schnell ab. „Aus der brauchst du dir nichts zu machen, - - - die hilft doch schon die ganze Woche bei uns drüben mit...!“
Eine Weihnachtsgeschichte von Gotthard B. Schicker:
Alles für die Katze
(Alles fer de Katz)
Unnre haamischn Fichtnwalder ham e Zeig im Aagebut, dos früher fei noch meh gebraucht worn is als heitzetag. Kaa arzgebirgscher Weihnachtsbarg kam uhne s Wald-Muus aus. Iech erinner miech an ahne Sach, wie se sich so üm de 50er Gahr bei uns derham in Annebarg ze Weihnachtn zugetrogn hot...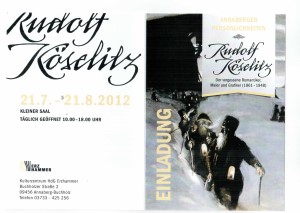
Unsere heimischen Fichtenwälder haben einen Artikel im Angebot, der in früheren Zeiten vielleicht noch mehr gebraucht wurde als heute.
Kein erzgebirgischer Weihnachtsberg kam ohne das Wald-Moos aus. Ich erinnere mich an eine Begebenheit, wie sie sich so etwa in den 50er Jahren bei uns daheim in Annaberg zu Weihnachten zu trug: Anfang Dezember war´s. Noch lag zwar kein Schnee, aber die Tage waren schon empfindlich kalt. Wie in so vielen erzgebirgischen Guten Stuben, wurde auch bei uns daheim alljährlich die „Weihnachtseck“ hergerichtet. Das Brett für den traditionellen Weihnachtsberg war schon vom Oberboten des alten Hut-Schmidt-Hauses geholt worden. Dort, wo unsere Krippenfiguren und das andere „Weihnachtszeig“ - die Pyramide, die zahlreichen Nussknacker und Räuchermänner, Engel und Bergmann und der Christbaumschmuck - ihren jährlichen Sommerschlaf hielten, sollen um 1510 die Kräuter der ersten Annaberger Apotheke getrocknet worden sein. Der Königliche Medicinalrat, Dr.Harms von Spreckel, meint in seinen Aufzeichnungen zur Geschichte der Annaberger Löwen-Apotheke dazu 1930: „Die Lage dieses Hauses konnte bisher nicht völlig sicher bestimmt werden. Nach der einen Deutung war es das früher Große Kirchgasse Nr. 12, jetzt Mittelgasse Nr. 2, gelegene Gebäude des Hutmachers Schmidt." Jedenfalls hat dieses Haus zwei Böden, und denkbar wäre es schon mit der einstmaligen Apotheke. Durch die Luft, die hier oben auf dem zweiten Boden ständig zirkulierte, war aber auch unser so dringend benötigtes Moos vom Vorjahr „furztrocken“, wie sich mein Papa auszudrücken pflegte, und zudem noch recht unansehnlich geworden.
Der Vater zog sich also flugs seine dicke Winterjoppe an, verpasste mir Mantel, Stiefel, Schal und Handschuhe, und ab ging es mit straffen Schritten hinaus aus dem Haus mit dem Metall-Zylinder an der Wand, - dem Pöhlberg zu. Dort kannten wir von all den Jahren zuvor die wunderbarsten Moos-Stellen in den hohen Fichtenwäldern. Herrlich grünes Gebirgsmoos, leicht feucht und würzig duftend, mit Fichtennadeln bestreut und ab und an mit einem Fichtenzapfen geschmückt. Der Spankorb war bald bis zum Rande gefüllt und die einbrechende Dunkelheit hätte uns sowieso am Weitersammeln gehindert. Der Heimweg führte denn an der alten Försterei vorbei, ein Stück dem Flößgraben entlang, um schließlich am St. Anna-Heim - in dem wir oft in diesen Tagen mit dem Kindertheater Weihnachtsmärchen probten und wo unsere Großmutter Lydia ihren Alterssitz hatte - in die Parkstraße einzuschwenken. Als wir an der Annenkirche angekommen waren, sahen wir schräg gegenüber, in Richtung Scheerbank, die freundlich-lockenden Lichter der wegen seiner Böhmischen Knödel weit über Annaberg hinaus bekannten Schänke „Zum Schwan“ blinken. Der Weg, den wir zum Pöhlberg rauf und wieder runter zurückgelegt hatten, war doch recht anstrengend. Mein Vater gönnte sich sicher die größte Freude selbst, indem er mir die Ermattung ansah und für Linderung im „Schwan“ sorgte.
Das Bier kostete damals nur ein paar Pfennige. Es wurde entweder in Holzfässern, oder in den beliebten Schnappverschluß-Flaschen von der Fiedler-Brauerei geliefert. Ich kann behaupten, dass es ein sehr schmackhaftes Bier war, wenn ich damals als kleiner Junge auch nur den Schaum vom Glas saugen durfte, so hab ich mich doch dann in späteren Jahren intensiver mit dieser und anderen Sorten aus erzgebirgischen Brauereien befassen und den Wohlgeschmack unseres heimischen Bieres verinnerlichen können.
Doch zurück zum Moos aus dem Fichtenwald: Nach den Erklärungen an die Mutter wegen der späten Heimkehr und den dafür vorgetragenen stichhaltigen Argumenten, die alle mit dem bekannten Mutter-Stöhnen quittiert wurden, konnte das Moos zur allgemeinen Bewunderung ausgepackt und zum Trocknen auf den lauwarmen Kachelofen geschichtet werden.
Ein Tag vor dem Heiligen Abend: Das Moos hatte die notwendige Trockenheit erreicht und die alljährliche Prozedur konnte beginnen. Mit allergrößter Sorgfalt wurden die Moosstücke über den vorderen Teil des großen Brettes verteilt, das den Weihnachtsberg tragen sollte. In die Mitte kam zunächst zusammengeknülltes Zeitungspapier, um es dann mit dem duftig-grünen Waldboden zu einem Berg zu formen. Um das Ganze kam ein Gartenzaun, dessen Latten-Spitzen mit Goldbronze nachgebessert wurden. Nun war der Höhepunkt erreicht: Die ersten Massefiguren - kurz nach dem II.Weltkrieg beim Annaberger Mannl-Lahl erstanden - entstiegen ihren Schachteln, um auf dem Berg trapiert zu werden. Mit einem unnachahmlichen Gefühl setzten die kräftigen Schuhmacherhände meines Vaters die zierlichen Hirten, Schafe und Kamele sowie den zarten Engel der Verkündigung an ihre angestammten Plätze um die Geburt des winzig-kleinen Kindes in der Krippe herum. Und da stand er dann selbst, der Namenspatron meines Vaters - Josef der Arbeiter. Neben ihm sein blau gewandetes und seltsam verzückt drein blickendes Weib - Maria. Die Frau meines Vaters, meine Mutter Magdalena, stand derweil gerührt mit dem jüngeren Bruder Reinhard auf der Zimmerschwelle, um von dort aus das feierliche Geschehen in der Guten Stube andächtig zu verfolgen. Selbstverständlich nebelte dabei auch das Raachermannl (Räuchermännchen) Schwaden gut abgelagerter, schwarzer Räucherkerzchen aus Crottendorf in die weihnachtliche Atmosphäre. Erzgebirgische Weihnachtslieder erklangen aus einem kleinen Kriegsradio, und zum Schnappverschluss-Bier aus Harnischs-Brauerei wurde ab und an von den Eltern ein selbst gemachter, recht scharfer Knoblauchschnaps genippt, der seit Jahren im Kohlenkeller der Tante Anna in der Kartengasse 8 vor sich hin reifte.
Nun also noch schnell das Kirchlein oben auf den Berg gestellt. Niemand störte sich daran, dass es ein evangelisches im ansonsten katholischen Hausstand war. Die Wege durch die Landschaft hin zum Gotteshaus wurden mit dem bewährten Scheuersand ATA markiert. Fertig war nunmehr das Prachtstück für die festliche Eröffnung am Heiligen Abend. Am Heiligen Morgen aber kam - wie in jedem Jahr so um die elfte Stunde - unser Onkel Bruno zum Weihnachtsbesuch, bzw. zur traditionellen Kräuterschnapsverkostung. Er war ein weit gereister Kaufmann und Drogist aus Annaberg, der mit seinen Olidäten im Koffer oder Bauchladen ein wenig über das Erzgebirge hinaus einen bescheidenen Handel trieb.
Es muss nach dem dritten oder vierten Glas dieser sagenhaften alkoholhaltigen Kräutermedizin gewesen sein, als meinem Vater einfiel – und das entgegen aller weihnachtlichen Maßregeln und familiären Traditionen - dem gut gelaunten Onkel Bruno unseren Weihnachtsberg vorzustellen. Mit einer von ihm ungewohnt großen und stolzen Geste öffnete er fast feierlich die Tür zum Zimmer, in dem der Weihnachtsberg stand. Der Onkel ging, nein, er schritt auf unser zeitweiliges Familienheiligtum gemessen zu, um alles begutachtend in Augenschein zu nehmen. Doch plötzlich ein Aufschrei im höchsten Männer-Diskant. Ein Ton, den bisher vermutlich noch niemand vom Kirchenchor-Sänger Bruno in dieser Höhe und Lautstärke vernommen hatte. Mit thatralischem Entsetzen sprang er aus dem Zimmer zurück, ließ sich schwer in seinen Kräuter-Schnaps-Sessel fallen und beklagte sich von dort aus mit hochdramatischen Ton und mit dunkelrot angelaufenem Kopf bei uns über die schamlose Entweihung der heiligen Stätte.-
Unsere Katze namens Muschi war es, die solcherart Entsetzen ausgelöst hatte. Sie war, von allen unbemerkt, in das besagte Zimmer geschlichen, ist auf den Weihnachtsberg gesprungen, hat einem Hirten und dem Heiligen Josef Ohrfeigen verpasst, um sich schließlich genüsslich in der Nähe von Ochs und Esel, neben der Krippe, auf dem duftenden Moos niederzulassen und dem Weihnachtstag entgegen zu schnurren. Das Entsetzen über den derart zugerichteten Weihnachtsberg war bei allen Beteiligten gewaltig.
Nach einem kräftigen Schluck vom Knoblich (Knoblauch)-Schnaps fand auch Onkel Bruno die weihnachtliche Fassung wieder und mein Vater Josef zeterte nur noch ein wenig im tiefsten Bass: „Alles fer de Katz! Alles für die Katz!“
 |
Nachwort
Erzgebirgische Mundart ins Hochdeutsche übertragen
„Jede Provinz liebt ihren Dialekt,
denn er ist doch eigentlich das Element,
aus welchem die Seele ihren Atem schöpft.“
Johann Wolfgang von Goethe
„Dichtung und Wahrheit“
Etliche Erzgebirger werden den Übertragungen der in erzgebirgischer Mundart verfassten Schnurren, Schnorken und Humoresken ins Hochdeutsche skeptisch, kopfschüttelnd oder gar ablehnend gegenüber stehen, weil sie ein Sakrileg verletzt meinen. Weil sie der Auffassung sind, dass sich da einer an ihrer ureigensten Sprache vergriffen und den Herzschlag eines alteingesessenen Volksstammes aus dem Rhythmus gebracht hat. Vergriffen hat er sich an einer besonderen Art, mit dem Munde zu reden, also an einer Mund-Art (Dialekt wird zwar synonym gebraucht, bildet aber den Inhalt nur ungenügend ab), in der man all ihre Geschichten so lebensnah erfühlen und erzählen kann, wie das im Hochdeutschen niemals der Fall sein wird. Diese Kritiker haben recht! Schließlich stellte bereits Goethe in „Dichtung und Wahrheit“ fest: „Beim Dialekt fängt die gesprochene Sprache an.“
Recht haben aber auch jene, die froh darüber sein werden, dass sie endlich verstehen, was da geschrieben steht über komische Begebenheiten, kuriose Gebirgsmenschen und allerlei Lebensweisheiten. Dass sie durch diesen „Dolmetscher“ endlich besser eine noch immer relativ unbekannte deutsche Landschaft sowie deren Menschen und ihre Sprache verstehen können, dürfte ein Gewinn für das Erzgebirge und seine Gäste sein.
Es bleibt unbestritten, dass die hier übertragenen erzgebirgischen Texte ins Hochdeutsche ihre literarische und emotionale Wirkung erst in der Mundart wirklich zur Geltung bringen können. Kein noch so treffendes Wort, keine noch so genaue Umschreibung in der Hochsprache kann die Farben, Nuancen und die Atmosphäre ersetzen, die aus der erzgebirgischen Mundart auf den Lesenden oder Zuhörenden herüber kommt. Voraussetzung dafür ist allerdings, dass man diese Sprache versteht, dass man die Worte entziffern und die Hintergründe erfühlen kann. Das ist aber letztlich nur dem vergönnt, der das Erzgebirgische quasi mit der Muttermilch eingesogen hat, der in dieser Sprache und mit ihr groß geworden ist und der sie auch heute noch sprechen, lesen, verstehen und erfühlen kann. Aber wer kann das so komplex noch wirklich?
Mit dem Sprechen dürfte es keine größeren Probleme geben, obwohl die ehemals reinen Mundartformen, wie sie in den Dörfern unterschiedlich gesprochen werden, immer mehr auch vom sächsischen Dialekt beeinflusst oder gar verdrängt wurden. Auch die kleinen und größeren „Völkerwanderungen“, bedingt durch Heirat, Kriege, Arbeitssuche oder Abenteurerlust, nahmen Einfluss auf diese Zurückdrängung, Verarmung oder das Absterben der erzgebirgischen Mundart, wie dies immer mal wieder prophezeit wird. Hinzu kommt, dass weder der sächsische Dialekt noch seine regionalen Mundarten derzeit im wiedervereinigten Deutschland hoffähig sind, wie das etwa zu Zeiten des Starken August der Fall war. Heute ist offenbar das Bayerische, Fränkisch oder Schwäbische salonfähig und kann problemlos in den Radio- und Fernsehsendern gesprochen werden, während das sprachverwandte Sächsisch belächelt und das Erzgebirgische als primitive Bauernsprache abgetan und höchstens zur Weihnachtszeit als folkloristisches Exoticum öffentlich-rechtlich und deutschlandweit zugelassen wird, - wenn man mal von den begrüßenswerten Versuchen des Mitteldeutschen Rundfunks absieht.
In den Schulen des Erzgebirges wird zwar die Mundart gesprochen, aber nur auf dem Schulhof oder auf dem Schulweg. Der Unterricht hat in Hochdeutsch, natürlich mit unvermeidlichem Erzgebirgsakzent auf beiden Seiten, zu erfolgen. Ein Fach zur Geschichte, Grammatik, Literatur sowie der Sprech- und Schreibweise der erzgebirgischen Mundart sucht man vergebens auf dem Lehrplan. Somit können zwar die Schülerinnen und Schüler das Erzgebirgische verstehen und auch sprechen, aber kaum noch lesen oder gar in Mundart Texte verfassen. So ist dann auch die Klage der Verlage nachzuvollziehen, dass Bücher in erzgebirgischer Mundart wie Blei in den Regalen liegen, während hochdeutsch geschriebene Texte über das Erzgebirge und seine Menschen mit ihrer seltsamen Sprache nach wie vor – und nicht nur von Einheimischen – einen relativ guten Absatz verzeichnen können.
Das Erzgebirge ist im vereinten Deutschland für viele Menschen, insbesondere in den westlichen Bundesländern, aber auch im westlichen Ausland, noch immer terra inkognito, mehr noch, als der Osten unseres Landes insgesamt. Von daher sind alle Anstrengungen im Bereich des Tourismus-Marketing zu begrüßen, wenn dort auch noch immer zu viel Bedächtigkeit waltet und die auch internationale Neugierde auf unseren Landstrich durch zu viel „Dienst nach Vorschrift“ von besoldeten städtischen Beamten und Angestellten ausgebremst werden. Ein Beispiel gewünscht? Bitte sehr: Stellen Sie sich einmal als interessierter Fremdling auf den Marktplatz von Annaberg-Buchholz, der Hauptstadt des Erzgebirges, und versuchen Sie durch Hinweise, Plakate, Modelle, Piktogramme o.ä. den Weg zu einer nahe liegenden Perle des Erzgebirges, zu einem einmaligen Kleinod Deutschlands wie den Frohnauer Hammer und sein ihn umgebendes historisches Ensemble zu finden. Fehlanzeige! Aber fragen Sie einen Einheimischen, und er wird ihnen den lohnenswerten Weg dorthin beschreiben – natürlich auf Erzgebirgisch.
Die hier übertragenen Texte von Erzgebirgs-Schriftstellern aus den letzten 100 Jahren kennt keiner von denen, die nach dem Frohnauer Hammer fragen, oder sich aus anderen Gründen in unsere Gegend verlaufen oder planvoll hier her gekommen sind. Wie um vieles besser würden sie all das bei uns Sehenswerte und Erlebte, ja uns selber besser verstehen, wenn sie auch diese Geschichten unserer Altvorderen lesen könnten. Sie würden dann etwas über die große Geschichte einer Grenzregion erfahren, wie sie sich auch im Kleinen – bis hinein in erzgebirgische Familien – zugetragen hat. Sie würde etwas erfahren von der heiteren Verschlagenheit, überlebenswichtigen Bauernschläue, zeitweilgen Schwermut, inständiger Heimatliebe, grotesken Humor, liebenswerter Naivität, oberflächlicher Frömmigkeit... Denn das, und noch viel mehr, beinhalten all jene Geschichten, die den erzgebirgischen Menschen besser charakterisieren, als es diese Zeilen auch nur im Ansatz vermögen. Aber all das erfahren weder unsere Gäste aus fernen Gegenden Deutschlands, noch die Mehrheit der Einheimischen. Wissenschaftler haben heraus gefunden, dass auch die Erzgebirger selbst nur noch in geringer Anzahl in der Lage sind, Mundarttexte zu lesen. Und noch weniger können Geschichten in unserer Sprache schreiben. Da sind solche Aktivitäten wie Mundart-Theater, Mundart-Gottesdienste oder Musik- und Heimatgruppengruppen, die in Mundart sprechen und singen, lobenswert und förderungswürdig. Sie bedienen aber hauptsächlich das Hören der Mundart, nicht so sehr die Fähigkeit zum Lesen oder gar Schreiben derselben. Der aktive Umgang mit der Mundart in Schriftform ist allerdings nicht nur im Erzgebirge auf dem Rückzug. Beim Plattdeutschen spricht man gar schon vom gänzlichen Verschwinden in ein paar Jahrzehnten. Aber nicht nur das Plattdeutsche, auch das Erzgebirgische, das Vogtländische, kurz, alle Basisdialekte – wobei hier Dialekt synonym für Mundart gebraucht wird - sind rückläufig und verlieren zunehmend an Sprechern, aber insbesondere an Lesern und Schreibern - und damit an Bedeutung. In seinem Buch „Pfälzisch“ aus dem Jahr 1990 meint Rudolf Post, dass z.B. die pfälzische Mundart mit jeder neuen Generation neun Prozent seines Wortschatzes verliert. „Dialekte sind heute nicht mehr fähig, eigenständige Neologismen (neue Dialekt-Wortschöpfungen, Anm. d .A.) gegenüber dem Hochdeutschen zu entwickeln, es wird stets der hochdeutsche Ausdruck verwendet“. Und der aus dem Vogtland stammende Volkskundler und Sprachwissenschaftler, Dr. Friedrich Barthel, meinte bereits 1956 im Nachwort zum Buch „Stimmen der Heimat“: „Die Mundart, das ist ihr unabdingbares Schicksal, wird dereinst absterben. Doch das liegt in weiter Ferne. Die Mundart ist die Sprache des Herzens. Wer sie spricht, schämt sich ihrer nicht. Er hält an ihr fest und spricht sie in den ihr jeweils zukommenden Situationen, die allerdings immer mehr eingeschränkt werden“. Diese Entwicklung kann nur dann verlangsamt werden, wenn in nächster Zeit ein Umdenken und pädagogisches Handeln einsetzt. In anderen deutschen Landen denkt man darüber nach, und in manch einer Gegend ist es schon Realität, Mundartunterricht auch in der Schule anzubieten – mündlich und schriftlich! Bis es aber auch im Erzgebirge so weit sein wird, besteht die Gefahr, dass die in den erzgebirgischen Texten enthaltenen Lebensweisheiten, historischen Verweise sowie die fast nur dort noch authentisch aufzufindende Lebenstätigkeit unserer Altvorderen im 19. und 20. Jahrhundert gänzlich in Vergessenheit geraten. Damit dies nicht geschieht, oder der Prozess verzögert wird, sollen durch eine behutsame Übertragung (keine Übersetzung) dieser Mundart-Texte in das Hochdeutsche deren Inhalte bewahrt und einem großen Leserkreis zugänglich gemacht werden. Neben dem Vorteil eines größeren Verbreitungsgrats dieser Geschichten, kann möglicherweise auch bei einem Teil der Leserschaft der Wunsch entstehen, diese Schnurren, Schnorken und Humoresken in der erzgebirgischen Originalsprache lesen zu wollen. Allerdings machen das bei den hier veröffentlichten Texten meist nur noch Archive und Antiquariate möglich. Ein paar Textproben sind deshalb auch zusätzlich in der erzgebirgischen Mundart veröffentlicht worden.
Aber es könnte ja auch sein, dass durch eine solche Übertragung heutigen Mundartschriftstellern damit eine größere Aufmerksamkeit zu teil wird und der Wunsch nach dem Originalklang der Sprache geweckt wird, mehr als das derzeit mit ihren Werken der Fall ist. Denn es bleibt dabei: Erzgebirgische Denkweise und Lebensart kann nur in der ihr adäquaten Sprache ausgedrückt werden – in einer der zahlreichen erzgebirgischen Mundart, die ja bekanntlich von Ort zu Ort gewisse Unterschiede aufweist. Eine Angelegenheit, die auch bei der Übertragung der Texte ins Hochdeutsche immer wieder auffiel und berücksichtigt werden musste.
Die hier veröffentlichten Autoren stammen zwar alle aus dem Erzgebirge, aber sie sind sowohl an der Grenze geboren, wie Anton Günther im böhmisch-erzgebirgischen Dorf Gottesgab (heute Stadt Bozi Dár), als auch in der Stadt, wie Heinrich Köselitz (Peter Gast), der aus Annaberg stammt und der, nach seiner Reise durch die Welt, dann als alter Mann seine Geschichten wieder in seiner Geburtsstadt schrieb. Bei beiden finden sich unterschiedliche Umsetzungen des gesprochenen Wortes in die Schriftsprache. Eben so bei Max Wenzel, der die Ehrenfriedersdorfer Mundart schrieb, bzw. Stefan Dittrich (Safenlob), der aus Eibenstock stammt und seine etwas andere Mundart in eine Schrift brachte, die insgesamt noch keine Vereinheitlichung aufweist, obwohl es im Jahr 1937 seitens des Erzgebirgsvereins Bestrebungen gab, die erzgebirgische Mundart in einer verbindlichen Lautschrift darzustellen. Letztlich ist es gut, dass es nicht dazu kam, denn es wäre ein Schlag gegen die Vielfalt unserer Muttersprache gewesen und eine Verarmung ihrer Ausdrucksmöglichkeiten.
Diese verschiedenen Varianten des Erzgebirgischen in Schriftform bereiten bei der Übertragung ins Hochdeutsche mitunter Schwierigkeiten und erfordern langes Nachdenken, Vergleiche anstellen und immer wieder ein lautes Vor-Sich-Hinsprechen. Da geht es u.a. um das Weglassen von Buchstaben oder Silben, Konsonantenaufweichungen (p=b, k=g), Vokalverlängerungen (Doppel „a“), oder aber Vokabeln, die nur in einem Ort so geschrieben werden, im anderen schon wieder anders. Man stolpert z.B. auch über solche Wortgetüme wie „hiimundriim“ oder „hümundrüm“ oder „hüm un drüm“, was man entweder mit „hüben und drüben“ oder „auf beiden Seiten“ übertragen kann. Auch „fedder“ und „feeder“ steht dann beide male für „weiter“ oder „vorwärts“. Ähnlich geht es mit „bleegng“ oder „blägn“, was für „laut schreien“ (bläken) unterschiedlich geschrieben wird. Verzweifeln dürfte aber jeder Nicht-Erzgebirger an dem Wörtchen „fei“, dass in unterschiedlichster Konnotation gebraucht wird und sowohl für „aber“ oder „endlich“, doch auch in manchen Zusammenhängen und beim anderen Mundartschriftsteller nach den deutschen Vokabeln „nämlich“, „ziemlich“ oder „freilich“ verlangt. Ganz zu schweigen von solchen Substantiven wie etwa „Seechams“ für „Ameise“, „Huchtsch“ für „Hochzeit“, „Zerwands“ für „Zerrwanst“ (Akkordeon), „Gudsager“ für „Gottesacker“ (Friedhof), „Dridewaar“ für „Trottier“ (Gehsteig), „Hitsch“ für „Fußbank“ oder das bekannte „Hiidrabradl“ oder „Hierachbraddl“ für „Hintragebrettchen/Hinreichbrettchen“ (Serviertablett), - um nur ein paar Kostproben zu geben. Diese Vokabeln sowie deren Unterschiede in der Schreibweise kann man nur verstehen, begreifen und gültig übertragen, wenn man mit der erzgebirgischen Muttersprache aufgewachsen ist, sie versteht und erfühlt, - selbst dann, wenn man sie nicht mehr ständig spricht.
Da mir also das Erzgebirgische von der Großmutter, einem Elternteil und vielen Verwandten quasi an der Wiege gesungen wurde, ich als Kind und Jugendlicher ständig mit ihr und in ihr lebte, sie verstehe und lesen, sie zu Hause auch heute noch sprechen, aber sie vor allen Dingen erfühlen kann, habe ich es gewagt, mich als ihr „Dolmetscher“ zur Verfügung zu stellen. Mögen also viele Leserinnen und Leser von diesen Übertragungen angeregt werden, den erzgebirgischen Menschen in seinem Verhalten und seinen jeweiligen Verhältnissen in einem wunderschönen deutschen Gebirge besser kennen lernen zu wollen. Denn wenn die Sprache ganz allgemein der konzentrierte Ausdruck des Denkens ist, dann ist die Mundart ihr Herz. Oder im Sinne Goethes „jenes Element, aus welchem die Seele ihren Atem schöpfe.“
Gotthard B. Schicker
Oktober 2016
Quellennachweis:
Walter Findeisen: „Liebelei im Arzgebirg“, Heimat-Verlag Lengefeld i. Erzgebirge, 1948
„Stimmen der Heimat“, Dichtungen in erzgebirgischer und vogtländischer Mundart, VEB Friedrich Hofmeister Leipzig, 1965
„Wos der Wenzel-Max derzehlt“, VEB Friedrich Hofmeister Leipzig, 1965
„Das Hans-Soph-Buch“, Leben und Werk des Erzgebirgssängers, Friedrich Hofmeister Leipzig, 1955
„Loßt eich derzehln“, Heitere Geschichten aus dem Erzgebirge von Otto Schwalbe, Union Verlag Berlin, 1954
„Verwerrtes Volk“, Humoresken von Heinrich Köselitz, Grasersche Buchhandlung (Richard Liesche) Verlag, Annaberg, 1893
„Das lustige Buch der Erzgebirger“, Stephan Dietrich (Saafnlob), VEB Friedrich Hofmeister Leipzig, 1954
Anton Günther: Gesamtausgabe, Glückauf-Verlag Schwarzenberg/Erzgebirge, 1937
|