|
Waldgang und Marzebilla
Das Schloss Schlettau lädt für den 9. März um 19.30 Uhr zu einer Buchlesung zum Buch „Waldgang“ und zur Vorführung des neuen Films "Marzebilla“ mit dem tschechischen Kulturwissenschaftler, Fotograf und Buchautor Petr Mikšíček ein. Karten (Vorverkauf: 3,00 Euro, Abendkasse: 3,50 € VVK) erhalten Sie über den Förderverein Schloss Schlettau e.V., info@schloss-schlettau.de bzw. Tel. 03733 / 66019. Mit Interview des Autoren.
Seit mehr als 10 Jahren setzt sich der bekannte Fotograf und Filmautor Petr Mikšíček mit seinen Recherchen und Kunstprojekten für Völkerverständigung zwischen tschechischen und deutschen Nachbarn ein, deren Verhältnis auch über 70 Jahre nach Kriegsende noch immer sensibel und von Ressentiments geprägt ist. Was stand am Anfang seiner Beschäftigung mit dem ehemaligen deutschsprachigen Grenzgebiet in der Tschechoslowakei? Während einer 90-tägigen und 1.000 Kilometer langen Fußwanderung im Jahr 2000 entdeckte er sein Interesse für diesen z.T. stark entsiedelten Landstrich zwischen Sachsen und Böhmen und entwickelte eine große Empathie für Landschaft und Menschen in jener Grenzgegend.
Dieser einsame „Waldgang“ lehrte dem jungen Mann ein Stück bisher unbekannte Heimatgeschichte und stellte zugleich ein tiefes Erlebnis auf seiner Suche nach Selbstbewusstsein dar.
 |
Seine ganz persönlichen Gefühle aus dieser „Wallfahrt“ – wie er diese Wanderung nennt – möchte der Autor mittels seinem Buch “Waldgang – Ein Streifzug zwischen deutscher Geschichte und tschechischer Gegenwart“ dem Publikum aufzeigen.
Zudem zeigt Petr Mikšíček an diesem Abend seinen Film „Marzebilla“ über um die gleichnamige erzgebirgische Sagenfigur.
Petr Mikšíček (*12. Mai 1977 in Prag) ist ein tschechischer Kulturwissenschaftler, Fotograf und Buchautor. Mikšíček studierte Kulturwissenschaften an der Philosophischen Fakultät der Universität Prag. In seiner Diplomarbeit beschäftigte er sich 2004 mit der Entwicklung der tschechischen Grenzgebiete im 20. Jahrhundert. Dieses Thema faszinierte ihn so sehr, dass er sich in den folgenden Jahren noch intensiver mit dieser Thematik beschäftigte und mehrere,
meist zweisprachige Publikationen darüber vorlegte und Filme über die genannten Themen produziert hat sowie weitere Projekte, wie das interkulturelle Festival „Land-Art-Treffen Königsmühle“ koordiniert.
Im Jahre 2004 wurde Petr Mikšíček mit dem Josef-Vavroušek-Preis ausgezeichnet, der nach dem tschechischen Bürgerrechtler, Ökologen und Politiker Josef Vavroušek (1944–1995) benannt ist und jährlich von der Karls-Universität in Prag verliehen wird. Mit diesem Preis wurde und wird sein Engagement für gesellschaftliche, kulturelle und menschliche Werte honoriert.
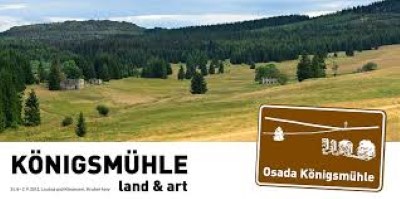 |
Interview, das Eva-Maria Simon von der Zeitschrift „Grenzwertig – Zeitschrift für Migration und Menschenrechte“ mit Petr Mikšíček führte:
„Viele Tschechen haben einen Komplex, was die gemeinsame Geschichte mit den Deutschen angeht“
Wer in Tschechien die Geschichte der Sudetendeutschen erkundet, macht sich nicht immer beliebt. Petr Mikšíček tut es trotzdem. Der Kulturwissenschaftler, Jahrgang 1977, macht sich gemeinsam mit deutschen Partnern auf die Suche nach verschwundenen Dörfern in den Grenzregionen. Mit Eva-Maria Simon sprach er darüber, warum das Erzgebirge für ihn die interessanteste Gegend der Welt ist.
Petr Mikšíček, Sie sind jung, Sie sind Tscheche, Sie kommen aus Prag. Warum interessieren Sie sich für einen „gottverlassenen“ Landstrich wie das tschechische Erzgebirge?
Weil ich dort als Kind so viele schöne Stunden verbracht habe. Meine Familie hat ein Wochenendhaus bei Nejdek, deutsch Neudek, rund 20 Kilometer von der Grenze. Irgendwann hat mir das Skifahren und Pilzesammeln nicht mehr gereicht. Da habe ich angefangen, mich mit der Geschichte zu beschäftigen.
Und das nicht nur ein bisschen.
Nein. Im Jahr 2000 habe ich eine Pilgerreise gemacht; ich bin drei Monate lang die Grenzen der Tschechischen Republik abgelaufen. Meine Bachelor-Arbeit in Kulturwissenschaften habe ich dann über Gesellschaft und Kultur der Sudetendeutschen bis zum Jahr 1945 geschrieben. Die Ausstellung „Das verschwundene Sudetenland“ ist an mehr als 40 Orten in Tschechien, Polen und Deutschland gezeigt worden. In meiner Diplomarbeit ging es um Vertreibung und Siedlungstätigkeit. Ich bin auch gerne in der Natur und fotografiere. So bin ich auf die Idee zu der Ausstellung und dem Buch „Das wiederentdeckte Erzgebirge“ gekommen.
Da zeigen Sie alte Aufnahmen von böhmischen Dörfern… Richtig?
Und daneben ein aktuelles Bild von einer leeren Wiese. Fast 70 Orte sind aus dem tschechischen Erzgebirge verschwunden, nachdem die deutschen Bewohner vertrieben waren. Zwei Drittel der damaligen Bevölkerung Tschechiens waren deutsch. Nach der Vertreibung und den Auswanderungswellen in den 60er Jahren waren die Grenzregionen entsiedelt. Damit beschäftigt sich in Tschechien kaum jemand außer uns.
Wer ist „wir“?
Die Organisation „Antikomplex“ und der Stiftungsfonds „Erneuerung des Erzgebirges“, den ich mit meinem Kollegen Antonín Herzán gegründet habe. Wir machen Projekte mit Schülern, grenzüberschreitende Wanderungen, Ausstellungen, Lesungen… Im Internet haben wir Berichte von mehr als 150 deutschen und tschechischen Zeitzeugen gesammelt.
Wofür steht der Name „Antikomplex“? Ich denke, dass viele Tschechen einen Komplex haben, wenn es um die gemeinsame Geschichte mit den Deutschen geht.
Kein Wunder. Die Vertreibung war eine Reaktion darauf, dass das Deutsche Reich die Sudetengebiete „angeschlossen“ und den Rest von Böhmen und Mähren besetzt hat. 
Das stimmt. Aber wir wollen zeigen, dass die Beziehungen zwischen Deutschen und Tschechen vielfältiger waren. In Tschechien wird wenig kontrovers über das Thema diskutiert. In der Schule lernt man nur: Alle Deutschen wollten heim ins Reich, unter der Führung der Sudetendeutschen Partei von Konrad Henlein. Sie wollten mit Hitler Europa vernichten, es gab nach dem Krieg keine andere Möglichkeit, als sie zu vertreiben. Aber wir kennen viele Leute, die mit ihrem Leben eine andere Geschichte erzählen. Da gab es eine sozialdemokratische Familie, die von den Nazis in ein Lager gesperrt wurde. Trotzdem sollte sie nach dem Krieg vertrieben werden. Ich habe von Deutschen gehört, die Flugblätter gegen Hitler über die Grenze ins deutsche Reich geschmuggelt haben. Und dann gab es diesen erzgebirgischen Schnitzer, der hat eine Weihnachtspyramide mit Karikaturen von Goebbels und Hitler gemacht. Das wussten die Leute, aber niemand hat ihn verraten. Andererseits gab es auch Nazis, die bleiben durften, weil sie in der Industrie gebraucht wurden.
Wie kommen Ihre Projekte bei Ihren Landsleuten an?
Insgesamt besser, als ich dachte. 90 Prozent der Reaktionen sind positiv. Allerdings sagen immer wieder Leute: Ihr solltet euch lieber mit den Opfern der Nazis beschäftigen und mit der Vertreibung der Tschechen. Und haben sie nicht recht? Natürlich ist das wichtig. Aber es gibt genug andere, die sich damit befassen. Wir wollen auf einer unpolitischen Basis die gemeinsame Geschichte entdecken.
Wie sind die Reaktionen in Deutschland?
Zu meinen Lesungen in Sachsen kommen immer viele Menschen. Die hungern richtig nach allem, was das Erzgebirge betrifft. Bei uns in Tschechien ist das anders.
Woran liegt das?
Nach der Vertreibung hat man Menschen aus der ganzen Republik im Erzgebirge angesiedelt, vor allem wegen des Bergbaus. Sie hatten keinen Bezug zur Region. Es gibt kein Heimatgefühl, nicht so viele Vereine, die Leute bleiben eher unter sich. Das ist traurig, aber andererseits macht es das Erzgebirge für mich zur interessantesten Gegend überhaupt.
 |
Warum?
Es ist doch auf tschechischer Seite vor allem ziemlich leer. Ich sage mir: „Happy people have no story.“ Im 20. Jahrhundert hat sich hier so viel verändert. Nach der Vertreibung kam das Uran-Fieber in Jáchymov. In den 50er Jahren zogen zehntausende Arbeiter dort hin, auch mein Großvater. Sie verdienten gutes Geld, aber setzten ihre Gesundheit aufs Spiel. Und als sich der Abbau nicht mehr lohnte, gingen viele weg. Die einstige Silberstadt Jáchymov, die früher Joachimsthal hieß, war berüchtigt: Dort mussten auch politische Gefangene das Uran aus dem Berg kratzen. Heute bröckeln dort die Fassaden und die Schaufenster werben für Geschäfte, die es nicht mehr gibt. Das Erzgebirge stand schon immer am Rand des Interesses. Im Bezirk Karlsbad zum Beispiel ist das Bruttoinlandsprodukt in den vergangenen 20 Jahren nur um fünf Prozent gewachsen. In anderen Bezirken hat es sich in diesem Zeitraum verdoppelt. Außerdem war die Natur sehr zerstört, auch wegen Torf- und Kohleabbau. Deshalb hat das Erzgebirge bis heute einen schlechten Namen in Tschechien.
Aber es gibt doch auch Schönes.
Ja, weil sich die Wirtschaft nicht so schnell entwickelt, haben wir noch viel Natur. Der schönste verschwundene Ort, den ich kenne, ist Königsmühle (Foto oben) oder Háje. Der liegt versteckt am Keilberg, dem höchsten Gipfel des Erzgebirges. Früher haben dort 50 Leute gewohnt, jetzt stehen noch sechs Ruinen von Häusern. Im Spätsommer werden wir dort ein deutsch-tschechisches Kulturfestival mit Theaterstücken veranstalten.
Wie leben Deutsche und Tschechen in der Region heute zusammen?
Wir haben ja ähnliche Probleme: Die jungen Leute gehen weg; es gibt viele Arbeitslose. Aber wir halten zusammen. Bei Antikomplex arbeiten zum Beispiel zwei Freiwillige aus Deutschland mit. Es gibt auch viele Freundschaften. Man muss eben seinen Kopf öffnen...
|